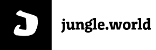Ein CSU-Minister als Vertreter der Landwirtschaftsindustrie gegen eine Ökokapitalistin mit SPD-Parteibuch. So stellte sich Ende November die Auseinandersetzung zur Verlängerung der Glyphosat-Zulassung in der EU da. Doch diese Personifizierung verstellt den Blick darauf, dass in einer Gesellschaft, in der der Profit das Maß aller Dinge ist, eben nicht die Frage der Gesundheit an erster Stelle steht. Davon berichtet sehr kenntnisreich der Leiter der Forschungsstelle Arbeit, Gesundheit und Biographie in Bremen Wolfgang Hien in seinen im VSA-Verlag erschienenen Buch „Kranke Arbeitswelt“.
Hien erinnert noch einmal an die Asbest-Katastrophe, die eigentlichen besser als Kriminalfall bezeichnet wird. Motiv: Profitsteigerung, Täter: Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Arbeitsmedizin, gedeckt wurden sie von DGB-Vorständen und jenen Teil der Lohnabhängigen, die für einen Arbeitsplatz über Leichen gehen.
„Leider muss zugleich festgehalten werden, dass auch führende Gewerkschaftler und viele Betriebsräte sich damals der Meinung anschlossen, ganz einfach auch deshalb, weil sie um ihre Arbeitsplätze fürchteten“, schreibt Hien. Er zeigt auch, mit welch harten Bandagen im wahrsten Sinne des Wortes auch unter Lohnabhängigen für die Arbeit mit gesundheitsschädlichen Materialen gekämpft wurde. Da wurde schon mal einen oppositioneller Betriebsrat nicht nur verbal sondern auch körperlich attackiert. Hien erinnert aber auch daran, wie in Italien Lohnabhängige gemeinsam mit AktivistInnen der außerparlamentarischen Linken gegen gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen aktiv geworden sind. Und er erinnert an oppositionelle GewerkschafterInnen wie die Echolot-Gruppe in der deutschen Chemieindustrie, die auch von den DGB-Gewerkschaften nicht unterstützt wurde.
Dabei geht es nicht um moralische Kritik. Das Kleinbürgertum in ihren Ökostadtteilen hat nun wahrlich keine Veranlassung, sich über Lohnabhängige zu mokieren, die angeblich zu dumm seien, um sich vor gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen. Nein, es ist die kapitalistische Profitgesellschaft, die Menschen so zurichtet, dass sie für einen Arbeitsplatz ihre Gesundheit zu ruinieren bereit sind. Hien jedenfalls stellt das in seinem Buch ganz klar.
Er macht nicht die Opfer dafür verantwortlich. Seine Kritik richtet sich an die WissenschaftlerInnen, darunter viele ArbeitsmedizinerInnen, und die Wirtschaftsverbände, die jahrelang gegen alle wissenschaftliche Evidenz bestritten, dass Asbest gesundheitsschädlich ist. Hien spricht sogar davon, dass sich führende WissenschaftlerInnen des Bundesgesundheitsamtes von der Asbestindustrie haben kaufen lassen. Eternit und andere Unternehmen und eben auch viele gekaufte Wissenschaftler behaupteten bis zuletzt, Asbest sei nicht oder nur gelegentlich gesundheitsschädlich.
Wenn man das Kapitel über den Kriminalfall Asbest und den langen Kampf liest, bis
auch die Wirtschaftsverbände nicht mehr verhindern konnten, dass Asbest als gesundheitsgefährdendes Material anerkannt wurde, erinnert man sich an das Diktum von Karl Marx Für 100 Prozent Profit geht das Kapital über Leichen. Während der Kriminalfall Asbest doch noch in Erinnerung geblieben ist, ist es Hien zu verdanken, noch einmal auf die Arsenkatastrophe an der Mosel erinnert zu haben. Dass von BASF produziert Insektenvernichtungsmittel Arsentrioxid verursachte viele tödliche Erkrankungen. Hien zeigt auf, wie ArbeitsmedizinerInnen noch versuchten, den Opfern nachträglich die Entschädigungszahlungen zu verweigern.
Heute werden die Gesundheitsgefahren exportiert
Hien ist auch weit davon entfernt, diese Probleme als nicht mehr aktuell darzustellen. Im Gegenteil wird heute das Gesundheitsproblem ausgelagert. LeiharbeiterInnen aus Osteuropa oder dem globalen Süden sterben in ihren Heimatländern an den Krankheiten, die sie sich bei gesundheitsgefährdenden Arbeiten im globalen Norden zugezogen haben. Oder das Giftmaterial wird gleich in den globalen Süden exportiert, was Hien am Beispiel der Demontage von Schiffen in Asien zeigt. Wenn aber in Indien oder Afrika Menschen an den Wohlstandsmüll aus dem globalen Norden sterben, erregt das längst nicht so sehr, als wenn nun das vielleicht gelegentlich gesundheitsschädliche Glyphosat im EU-Raum zum Einsatz kommt. Gerade das ökokapitalistische Kleinbürgertum empört sich nur gelegentlich, wenn im globalen Süden Menschen krank werden für den Wohlstand im Norden. In der Debatte um das möglicherweise „gelegentlich gesundheitsschädliche“ Glyphosat ist aber nur glaubwürdig, wer die hohe Messlatte für mögliche Gesundheitsgefährdungen global anlegt. Und wer das Problem beim Namen nennt, das Kapitalismus heißt.
aus Graswurzelrevolution Januar 2018
http://www.graswurzel.net/425/
Peter Nowak
Hien Wolfgang, Kranke Arbeitswelt, VSA-Verlag, 200 Seiten, EUR 16.80 , ISBN 978-3-89965-703-6