
Wir rufen die Verantwortlichen der Konfliktparteien und der USA dazu auf, alles daran zu setzen, konstruktive und effektive ….
„Neutralität der Ukraine ist das Gebot der Stunde“ weiterlesenZeitungsartikel des Journalisten Peter Nowak

Wir rufen die Verantwortlichen der Konfliktparteien und der USA dazu auf, alles daran zu setzen, konstruktive und effektive ….
„Neutralität der Ukraine ist das Gebot der Stunde“ weiterlesen
Wer pflückt unsere Erdbeeren? Wer erntet den Spargel“ Wer putzt, pflegt und bringt die Pakete? Je schlechter eine Arbeit, je Mieser bezahlt, desto stärker setzt die Branche migrantische Arbeit ein. Kapitalistische Logik: Menschen, die die Landessprache nicht sprechen; Menschen, die die Gesetze nicht kennen; Menschen, die Geld brauchen, weil sich in ihrer Heimat der Kapitalismus ohne soziale Maske zeigt, lassen sich leichter ausbeuten. Peter Nowak schreibt über die migrantische Arbeit in Deutschland und das System der Subunternehmen. …
„Arbeitskampf als verlorene Zeit?“ weiterlesen
Am Freitag werden in Berlin manche Menschen erstaunt vor verschlossenen Läden und Büros stehen. Denn nicht alle werden mitbekommen haben, dass in diesem Jahr in der Hauptstadt der Internationale Frauentag am 8. März zum neuen Feiertag [1] wurde.
Das hat die Koalition aus SPD, Grüne und Linke beschlossen und damit auch noch Clara Zetkin Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Auf die Sozialistin und Frauenrechtlerin geht der 8. März zurück. Weil Zetkin, die an der Seite von Rosa Luxemburg am linken Flügel der SPD stand, 1919 KPD-Mitglied wurde, galt sie manchen nach 1989 nicht mehr würdig, als Namensgeberin von Straßen zu fungieren. Es gab in verschiedenen Städten Umbenennungen.
„Keiner schiebt uns weg“ weiterlesen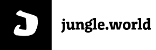
Ende vergangenen Jahres wurde es eng im größten Hörsaal der Universität Kassel. Knapp 500 Beschäftigte der Hochschule nahmen am 13. Dezember an einer außerordentlichen Personalversammlung teil. Sie forderten…
„Unbefristeter Stress“ weiterlesen
Mit diesen Sätzen beschreibt Wolfgang Hien sein langjähriges Engagement für den Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt. Warum das Thema zu seiner Lebensaufgabe wurde, kann man in einem langen Gespräch erfahren, das Hien mit dem Historiker Peter Birke geführt hat. Im VSA-Verlag ist es unter dem Titel…
„GEGEN DIE ZERSTÖRUNG VON HERZ UND HIRN“ weiterlesenSchlecht, wenn der Job an die Nieren geht. Und ans Hirn
Die neoliberale Radikalisierung in der Arbeitswelt, sagt Wolfgang Hien, bürde Körper, Geist und Seele hohe Belastungen auf. Die Folge: Arbeitsbedingte Krankheiten nehmen zu. „Dieser Entwicklung sollte Einhalt geboten werden. Dafür möchte ich meine arbeits- und gesundheitswissenschaftliche Kompetenz einsetzen.“ Damit hat Hien, geboren 1949 im Saarland, sein lebenslanges Engagement für den Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt recht gut beschrieben. Warum das Thema zu seiner Lebensaufgabe wurde, kann man in dem langen Gespräch erfahren, das Hien mit dem Historiker Peter Birke geführt hat, und woraus „Gegen die Zerstörung von Herz und Hirn“ besteht. Hien beginnt damit, wie ihn seine Erfahrungen als Auszubildender beim Chemieriesen BASF in Ludwigshafen geprägt haben. Dann klärt er auch die Verwirrung auf, die der Untertitel „68 und das Ringen um eine menschenwürdige Arbeit“ bei manchen auslösen mag. Schließlich schien Hien im BASF-Labor weit weg von den Unis, in denen Studierende Marx und Adorno zu lesen begannen.
Doch Hien beschreibt einprägsam, wie sehr ihn und einige BASF-Kollegen der gesellschaftliche Aufbruch Ende der 1960er Jahre beeinflusste. Wie er nach einigen Jahren die Fabrik verließ, das Abitur nachholte und ein Studium begann. Und wie er auch danach den Kampf um den Gesundheitsschutz in der Chemieindustrie fortsetzte.
Peter Birke, eine Generation jünger als sein Gesprächspartner, gelingt es, die Biographie Hiens auszuleuchten und zugleich Elemente einer Gegengeschichte der Industriearbeit in Deutschland aufzuzeichnen: Etwa wenn Hien von der Kooperation zwischen Umweltinitiativen und kritischen Gewerkschaftern erzählt, die es in den 1980er Jahren auch in der Chemiebranche gab. „Mitmischer“ nannte sich eine der Gruppen im Rhein-Main-Gebiet, in der Hien gemeinsam mit Chemiearbeitern organisiert war, „Mitmischer“ nannte sich auch eine Betriebszeitung, die in einer Auflage von 10 000 Exemplaren von den 1970er bis in die 1990er Jahre bei BASF Ludwigshafen verteilt wurde. Fast in jeder Nummer wurden die Kollegen über die giftigen Substanzen informiert, mit denen sie ständig in Berührung kamen.
Der gut besuchte Alternative Gesundheitstag 1980 in Berlin gab Hien Inspiration für sein Engagement, Betriebsbasisgruppen für Gesundheit aufzubauen. Mit den esoterischen Strömungen, in die Teile der Gesundheitsbewegung später abdrifteten, hatte er nichts im Sinn. Ihm ging es darum, den Bedingungen in der Arbeitswelt den Kampf anzusagen, die die Menschen krank machen. Zu seinen Kontrahenten gehörten dabei nicht nur Industrieverbände, sondern oft auch Betriebsräte und Gewerkschaften, die auf Sozialpartnerschaft setzten. Deshalb war es für viele eine Überraschung, dass Hien 2003 Referent für Gesundheitsschutz beim DGB-Vorstand wurde.
Doch schnell geriet er mit seinen Engagement für eine Arbeitswelt, in der auch die Langsamen und chronisch Kranken ihren Platz haben sollen, in Konflikt mit einer Gewerkschaftslogik, die Arbeitsplätze vor Gesundheitsschutz stellt. Hien beschäftigt vielmehr die Frage, wie Lohnarbeit so gestaltet werden kann, dass auch Alte, Kranke und Schwache darin ihren Platz finden.
In einer Zeit, in der Beschäftigte ständig erreichbar und flexibel sein sollen, hat diese Fragestellung nichts von ihrer Dringlichkeit verloren. So ist der Gesprächsband nicht nur Erinnerung an linke Geschichte, sondern auch ein sehr aktuelles Buch.
Peter Nowak
Gegen die Zerstörung von Herz und Hirn – „68“und das Ringen um Menschenwürde Arbeit, Wolfgang Hien, Peter Birke, VSA-Verlag 2018, 256 Seiten, 22,80 Euro,
aus Wochenzeitung Freitag, Nr. 43, 25.Oktober 2018,

»Ich hatte das Gymnasium nach der siebten Klasse abgebrochen. „Umgekehrter 68er“ weiterlesen
Der Kampf gegen prekäre Arbeit in landeseigenen Unternehmen geht weiter
»Prekär und tariffrei, nicht mit uns«, steht auf dem Schild, das ein wütender Bär schwenkt. So präsentiert sich der im Herbst 2015 gegründete Gewerkschaftliche Aktionsausschuss (GA) im Internet. »Überall da, wo es prekäre und tariffreie Arbeit gibt, müssen gewerkschaftliche Strukturen entstehen und gestärkt werden«, lautet das Ziel der GA. Am Mittwoch wurde auf einer Veranstaltung im Berliner Haus der Buchdrucker deutlich, dass die Arbeit schon Früchte trägt.
Der ehemalige Betriebsrat des Botanischen Gartens, Lukas S., schilderte sehr präzise, wie sich die Kolleg*innen »von der Pike« auf gewerkschaftlich in der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di organisierten. Doch Schmolzi betonte auch, wie wichtig bei dem Arbeitskampf die solidarische Unterstützung von Organisationen wie der Berliner Aktion gegen Arbeitsunrecht (BAGA) und linken Studierendenorganisationen war. Zur Hilfe kam ihnen auch die Tatsache, dass der Botanische Garten in der Berliner Bevölkerung sehr populär ist. Das Presseecho sei bei diesem Arbeitskampf immer sehr gut gewesen, betonte die ver.di-Gewerkschaftssekretärin Jana Seppelt. Bei anderen Arbeitskämpfen sie das längst nicht immer der Fall. Deshalb habe man auch ein Buch unter dem Titel »Der Aufstand der Töchter« herausgegeben, in dem die Geschichte eines erfolgreichen Arbeitskampfes noch einmal akribisch nachgezeichnet wird.
In der Veranstaltung ging es auch um die Frage, wie dieses erfolgreiche Beispiel auf andere Bereiche wie Museen, Freie Träger, Bibliotheken und Volkshochschulen übertragen werden kann. Welche Probleme dabei entstehen können machte der Abgeordnete der LINKEN im Abgeordnetenhaus, Tobias Schulze, deutlich. So kollidiert der Plan des Berliner Senats, Vivantes finanzielle Zuschüsse zu zahlen, wenn damit die Löhne der Beschäftigten erhöht werden, mit EU-Wettbewerbsrecht.
Gotthard Krupp, der als freiberuflicher Künstler Mitglied bei ver.di ist, sieht den gewerkschaftlichen Aktionsausschuss nicht nur als Instrument der Vernetzung und Koordination. Wichtiger noch sei, dass er die Fragen der prekären Löhne auf die politische Ebene gehoben hat. Wie im Fall des Botanischen Gartens habe ein Arbeitskampf immer dann Erfolg gehabt, wenn sich Politiker*innen die Forderungen zu Eigen gemacht haben. Streiks alleine würden nicht ausreichen.
Dem mochte Jana Seppelt nur teilweise zustimmen. Die Kampfbereitschaft der Beschäftigten ist die Grundlage, dass sich auch Politiker*innen des Themas annehmen. Seppelt stimmte Krupps Kritik am restriktiven Streikrecht in Deutschland ausdrücklich zu. Das lässt es nicht zu, dass Beschäftigte gegen Outsourcing von Firmenteilen in den Streik treten. Wie schwer ein Arbeitskampf gegen prekäre Arbeitsverhältnisse sein kann, zeigte der Streik der Beschäftigten des landeseigenen Klinikkonzerns Vivantes, der die Operationssäle teilweise lahm legte. Es gab sehr negative Artikel in vielen Zeitungen.
Mittlerweile hat die Tarifkommission der Vivantes Service GmbH eine Erklärung verfasst, die von mehreren Gewerkschaft*innen aus ganz Deutschland unterzeichnet wurde. »Der Streik war ein Warm-up auf dem Weg zu einer hundertprozentigen Eingliederung in den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes. Darauf bereiten wir uns schon jetzt vor«, erklärte ein Vivantes-Beschäftigter.
Eine Krankenhausbeschäftigte aus dem Publikum wollte wissen, wie sie streiken kann, wenn sowieso ständig Personalnotstand auf ihrer Station sei. »Da ist ständig Notstand und wenn wir streiken, gibt es niemand, der sich um die Patient*innen kümmert«, erklärte sie. Benjamin Roscher vom ver.di-Fachbereich »Besondere Dienstleistungen« verwies auf Erfahrungen bei Arbeitskämpfen der Charité, aber auch bei den Kliniken im Saarland. Dort sei deutlich geworden, dass auch in den Kliniken Arbeitskämpfe möglich sind. Sie müssen allerdings den Patient*innen vermittelbar sein, betonte auch Jana Seppelt.
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1092724.botanischer-garten-als-vorbild.html
Peter Nowak

Das Buch zum Arbeitskampf
Buch: Jana Seppelt, Reinhold Niemerg u. a. (Hg.): „Der Aufstand der Töchter, Botanischer Garten Berlin. Gemeinsam staatlich organisierte prekäre Beschäftigung überwinden“, VSA-Verlag, 2018, 16 Euro
Inhalt: Im Buch wird beschrieben, wie es den ausgegliederten und von Lohndumping geplagten Beschäftigten des Botanischen Gartens gelungen ist, sich in den öffentlichen Dienst zurückzukämpfen.
Vorstellung: Am 27. Juni wird das Buch um 19 Uhr in der Mediengalerie des Hauses der Buchdrucker in der Dudenstraße 10 in Schöneberg vorgestellt.
taz: Herr Schmolzi, wie kam es überhaupt zu der Idee, ein Buch über Ihren Arbeitskampf zu machen?

Die Abgastests an Menschen haben Schlagzeilen gemacht, PolitikerInnen aller Parteien äusserten sich empört und der verantwortliche Konzern sagt, dass soll nicht mehr vorkommen. Warum diese Aufregung?

Telepolis sprach mit Wolfgang Hien[1] vom Bremer Forschungsbüro für Arbeit, Gesundheit und Biographie. Hien beschäftigt sich mit Gesundheitsbelastungen innerhalb der Wohn- und Arbeitswelt. Im VSA-Verlag ist sein Buch „Kranke Arbeitswelt“[2] erschienen.
Hat nicht auch die Umweltwissenschaft versagt,…
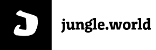
Wolfgang Hien ist Arbeitswissenschaftler und Medizinsoziologe. Er leitet die Forschungsstelle Arbeit, Gesundheit und Biographie in Bremen und beschäftigt sich mit Gesundheitsbelastungen innerhalb der Wohn- und Arbeitswelt. Im VSA-Verlag ist sein Buch »Kranke Arbeitswelt« erschienen.
Am 9. Februar hält er im FAU-Lokal in Berlin einen Vortrag zum selben Thema.

Nicht dass Affen und Menschen im Labor Tests über die Schädlichkeit von Abgasen unterzogen werden, ist das Problem, sondern die alltäglichen Menschenversuche der Autoindustrie auf unseren Straßen
„Tests in keiner Weise zu rechtfertigen“: Das war am Montag der Tenor, als durch einen Artikel der New York Times bekannt wurde, dass die deutsche Automobilindustrie Untersuchungen in Auftrag gegeben habe, um die angebliche Unschädlichkeit der Dieselmotoren zu belegen.
Von Angela Merkel bis Katja Kipping gab es bald keinen Politiker und keine Politikerin mehr, der oder die nicht Empörung über diese Versuche äußerte. Doch meistens kam die Kritik nicht über eine moralische Verurteilung hinaus. „Unangemessen“ und „menschenverachtend“ waren die Vokabeln.
Dabei wäre es doch sinnvoller, erst einmal zu schauen, was da eigentlich passiert ist und wie sich die Versuche von den vielen anderen unterscheiden, die tagtäglich gemacht werden.

In einer Gesellschaft, in der der Profit das Maß aller Dinge ist, stehen eben nicht Gesundheitsfragen an erster Stelle
Ein CSU-Minister macht in Brüssel einen Alleingang und sorgt so dafür, dass Unkrautmittel Glyphosat erst einmal weiter verwendet werden kann. Nun blicken alle politischen Beobachter auf die Folgen für die neuen Sondierungsgespräche zwischen der SPD und der Union. „Glyphosat-Streit: Profit gegen Gesundheit“ weiterlesen