An einem Gericht in der polnischen Stadt Gorzów findet demnächst ein Prozess statt, der für die Arbeitsverhältnisse im gesamten Gesundheitswesen des Landes von Bedeutung ist. Norbert Kollenda war bei Attac für die Kontakte zu den sozialen Bewegungen in Polen zuständig und beteiligt sich an der Kooperation von Basisgewerkschaften.
Sie rufen zur solidarischen Begleitung des Arbeitsgerichtsprozesses von am 24. November auf. Um was geht es?
Barbara Rosołowska will erreichen, dass die Klinik die Form ihrer Anstellung von einem Vertrag als Selbständige zu einem regulären Arbeitsvertrag ändert. Weil ihre bisherigen Bemühungen nicht fruchteten, hat sie sich an das Arbeitsgericht gewandt. Hier geht es darum zu zeigen, dass sie nicht die einzige ist, die als Scheinselbständige arbeitet und die gleiche Arbeit verrichtet wie die anderen. Eine Zeugin wurde von der Richterin gefragt, warum sie denn diese Anstellung gewählt habe, wenn sie der Meinung sei, dass dies ungünstig sei. Daraufhin sagte die Zeugin unter Tränen: »Was hätte ich denn machen sollen? Nach 23 Jahren wurde ich entlassen und das war die einzige Bedingung, unter der ich eingestellt wurde!« Die Richterin erwiderte darauf: »Sie sind hier vor Gericht, halten sie ihre Emotionen im Zaum!«
Sind das Einzelfälle oder ist das Alltag in polnischen Kliniken?
Es scheint so zu sein, dass die Kliniken mit der Scheinselbständigkeit den großen Mangel an Beschäftigten ausgleichen wollen. Denn in vergleichbaren Fällen können diese bis zu 300 oder sogar 350 Stunden im Monat arbeiten. Es gibt Schwestern und Hebammen, die Zwölf-Stunden-Schichten schieben und kaum einmal frei machen. Damit gefährden sie nicht nur ihre Gesundheit.
Rosołowska gehört zur anarchosyndikalistischen »Arbeiterinitiative«. Wird sie auch von anderen Gewerkschaften unterstützt?
An der Basis gibt es auch aus den anderen Gewerkschaften Unterstützung. Bei der Verhandlung am 24. November wird als Zeuge der Vorsitzende der Gewerkschaftsgruppe von Solidarność in der Klinik vernommen. Wir können gespannt sein, was er zu den Arbeitsbedingungen zu sagen hat.
Vor einigen Jahren haben in Warschau Krankenschwestern gestreikt. Gibt es im polnischen Care-Sektor gewerkschaftlichen Widerstand?
Leider ist die Gründung einer einheitlichen Gewerkschaft für die Beschäftigten im Gesundheitswesen in Polen bisher gescheitert. Die größte ist die Gewerkschaft der Krankenschwestern und Hebammen, die dem Dachverband »Forum der Gewerkschaften« angehört. Sie hatten eine äußerst aktive Vorsitzende, die zusammen mit der Gewerkschaft »Sierpień 80« ein europäisches Netzwerk aufbauen wollte. Aber sie wurde nicht wiedergewählt.
Zahlreiche Care-Beschäftigte aus Polen arbeiten in Deutschland. Welche Auswirkungen hat das auf das Gesundheitswesen in Polen?
Barbara Rosołowska verdient mit ihren 14 Diensten á zwölf Stunden brutto 4 200 Zloty, es bleiben netto 2 000 Zloty, das sind ungefähr 500 Euro. Nach Gorzów hat sie in nur unregelmäßigen Abständen eine Verbindung mit dem Zug. Stündlich fährt ein Zug nach Berlin, wo sie mindestens das Dreifache verdienen würde. Aber als aktive Gewerkschafterin denkt sie nicht nur an sich. In Deutschland kommen etwas mehr als elf und in Polen vier Krankenpfleger auf 1 000 Einwohner. Es fehlen 100 000 Pflegekräfte und von den 250 000 Beschäftigten sind zwei Drittel zwischen 40 und 60 Jahre alt. Das ist schon lange bekannt, aber bisher hat keine Regierung etwas unternommen. Es gibt keine einheitlichen Löhne, fast jede Klinik verhandelt über die Tarife selbst. Vermittler aus Westeuropa warten schon auf die jährlich 5 000 Absolventen der Krankenpflegeschulen, von denen zwei Drittel den Beruf nicht in Polen aufnehmen.
http://jungle-world.com/artikel/2016/44/55125.html
Small Talk von Peter Nowak
——————————————————————————————————————————————————-
Wer kommt am 24. 11. mit auf die andere Oderseite?
Klage für eine Festeinstellung
Die Kliniken in Polen haben eine Form gefunden, um dem Mangel am mittleren medizinischen Personal Herr zu werden. Zunehmend werden die Kräfte auf zivilrechtlicher Basis – also Scheinselbstständige – eingestellt, denn sie dürfen sogar bis zu 350 Stunden im Monat arbeiten. Bei der Arbeitslosigkeit in vielen Gegenden sind die Frauen dankbar, haben doch oft die Männer keine Arbeit. Und die Kolleginnen und Patienten haben es mit Gestressten zu tun.
Dies hat auch Barbara Rosolowska von der Gewerkschaft „Arbeiter Initiative“ erfahren müssen. Bis 2007 hat sie in der Klinik in Kostrzyn (Küstrin auf der polnischen Oderseite) gearbeitet, aber dann kam der Gerichtsvollzieher wegen der enormen Schulden der Klinik und sperrte die Konten. Worauf Löhne nicht ausgezahlt wurden – die Klinik wurde privatisiert auch Barbara wurde entlassen – erst nach vielen Aktionen und Protesten nach 7 Jahren gab es die ausstehenden Löhne. Nun ist Barbara der Meinung es wäre uns zu verdanken, dass sie ihr Geld endlich bekommen hätten. Die Bürgermeisterin wurde nämlich bei einem Treffen mit KollegenInnen im Brandenburgischen danach gefragt, worauf sie wütend nach Warschau um das Geld gefahren sei. Wir hatten bei einer Kundgebung teilgenommen und ich hatte darüber berichtet. Wenn es denn so gewesen ist…
Nach zwei Jahren ließ sie sich darauf ein im Regionalkrankenhaus als Scheinselbstständige zu arbeiten – arbeitslos wollte sie nicht bleiben. Bei ihren 14 Diensten zu 12 Stunden im Monat bleiben ihr bei 4200 Brutto 2000 Zloty – ca. 500 Euro.
Sie hätte es sich auch einfach machen können. Von Kostrzyn an der Oder fahren unregelmäßig Züge nach Gorzow, um in die Klinik zu kommen, aber stündlich fahren Züge nach Berlin, die Fahrzeit ist zwar doppelt solang, aber sicherlich hätte sie dort den dreifachen Lohn!
Jedoch als Mitglied der Basisgewerkschaft Arbeiter Initiative will sie auch ein Zeichen setzen und die Kolleginnen und Kollegen dazu anregen auch gegen diese Scheinselbstständigkeit vorzugehen. Sie reichte Klage gegen ihren Arbeitgeber ein um eine Festeinstellung nach dem Arbeitskodex zu erreichen.
Die nächste Verhandlung ist in Gorzow WLKP am
24. November um 12.30 Uhr
Es wäre schön, wenn ich nicht allein fahren müsste, ausländische Gäste machen immer Eindruck und kommen eher in die Medien!
Züge fahren von Lichtenberg ab 09.37 Uhr mit Anschluss in Kostrzyn (Küstrin) an 11.42 in Gorzow – Fahrpreis 24,60 € Tageskarte, 8,20 € Anschluss-Tageskarte für Inhaber von 65+u.ä.
Wer mitfahren will kann sich gern mit mir in Verbindung setzen, da würde ich noch ein Gespräch mit Barbara Rosolowska und ihrem Anwalt organisieren
Mit solidarischen Grüßen!
Norbert Kollenda
Berlin-Pankow
+4930-47370845
mobil:0176/93 60 99 79

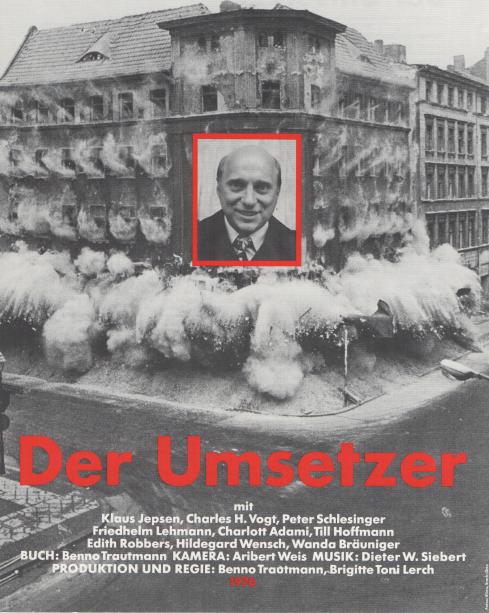

 Bild: K. Culina // CC BY-SA 4.0
Bild: K. Culina // CC BY-SA 4.0