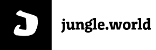
Wie ist der Stand der Organisierung bei der GG/BO?
Als die Gewerkschaft im Mai 2014 in der JVA Tegel gegründet wurde, konnte niemand ahnen, dass…
Zeitungsartikel des Journalisten Peter Nowak
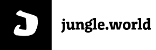
Wie ist der Stand der Organisierung bei der GG/BO?
Als die Gewerkschaft im Mai 2014 in der JVA Tegel gegründet wurde, konnte niemand ahnen, dass…
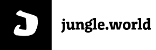
Helge Lehmann ist IT-Spezialist und war Betriebsrat in einem transnationalen Unternehmen. 2011 gab er nach mehrjährigen Recherchen das Buch »Die Todesnacht in Stammheim. Eine Untersuchung: Indizienprozess gegen die staatsoffizielle Darstellung und das Todesermittlungsverfahren« heraus.

Der Tatort-Krimi Der rote Schatten[1], der am letzten Sonntag ausgestrahlt wurde, hat ein Verdienst. Er lenkt noch einmal die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass zahlreiche Widersprüche zur offiziellen Version der Todesumstände der RAF-Gefangenen am 18.Oktober 1977 in dem Isolationstrakt von Stammheim unaufgeklärt sind.
„Stammheimer Todesnacht: Es bleiben zahlreiche Widersprüche“ weiterlesen
Warum bezweifeln Sie noch immer, dass die RAF-Gefangenen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan Carl Raspe Selbstmord verübt haben?
Exakt 17 Stunden und 13 Minuten brauchten MitarbeiterInnen der Polizei und der Justiz, um eine ungewöhnliche Strafanzeige zu bearbeiten. Ein Mann soll eine Polizistin beleidigt haben, weil er bei einer Personenkontrolle in ihrer Nähe gefurzt habe. Der Mann bekam einen Strafbefehl über 900 Euro. Nachdem er Widerspruch einlegte, stellte das Amtsgericht Tiergarten das Gerichtsverfahren umgehend ein. Die Kosten für den Prozess und den Anwalt des Angeklagten übernahm die Staatskasse.
»Wir haben wirklich andere Probleme in Berlin und hätten das Geld besser für die Prävention und die strafrechtliche Verfolgung von islamistischen Straftaten verwenden können«, kritisiert Sebastian Schlüsselburg, Rechtsexperte der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, den Verfolgungseifer wegen etwas heißer Luft.
Schlüsselburg hatte eine Schriftliche Anfrage nach dem Zeitaufwand der Ermittlungen gestellt. Er zeigte sich im nd-Gespräch »verwundert, dass die Staatsanwaltschaft nicht frühzeitig von ihrer Möglichkeit der Einstellung des Verfahrens Gebrauch gemacht hat«. Unverständlich findet es der Politiker auch, dass nicht die Polizistin, die den Furz wahrgenommen hatte, sondern ihr Einsatzleiter die Anzeige stellte.
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1066673.polizei-berlin-justizposse-um-furz-gegen-polizei.html
Peter Nowak
Ein Furz bei einer Personenkontrolle in der Rigaer Straße sorgt für Nachwehen. Abgeordneter Sebastian Schlüssenburg (Linke) ließ die Kosten errechnen
Viel Spott zogen sich die Justizbehörden zu, nachdem bekannt geworden war, dass Christopher S. einen Strafbefehl von 900 Euro erhalten hatte, weil er bei einer Personenkontrolle in der Rigaer Straße in der Nähe einer Polizistin einen Furz gelassen hatte. Nicht die Beamtin, son dern der Einsatzleiter stellte eine Anzeige. Für Christopher S. ging die Angelegenheit glimpflich aus. Das Berliner Amtsgericht stellte das Verfahren ein. Viel Wind um nichts, lautete der kurze Kommentar einer Prozessbesucherin. Doch umsonst war die Justizposse keineswegs.
Sebastian Schlüsselburg, Mitglied der Linken im Abgeordnetenhaus wollte vom Senat wis sen, wie hoch der Zeitaufwand und die Kosten für die Ermittlungen im Furz-Verfahren war.
In ihrer Antwort listete Martina Gerlach, Staatssekretärin für Justiz und Verbraucherschutz, auf, dass 23 Dienstkräfte mit einem Zeitaufwand von 17 Stun den und 13 Minuten mit der Bearbeitung des Falls beschäftigt waren. Die Zeit setze sich „zusammen aus den polizeilichen Maßnahmen vor Ort, der späteren Sachbearbeitung und dem zeitlichen Aufwand für die richterliche Vorladung“.
Die MitarbeiterInnen von Schlüsselburg errechneten aus diesen Angaben Kosten in Höhe von lediglich 87,25 Euro. „In die ser Rechnung werden die Arbeitsaufwendungen der Mitar beiterInnen von Gericht und Staatsanwaltschaft nicht mit einbezogen“, erklärte Schlüsselburg gegenüber der taz. Auch die Kosten des nach 20 Minuten mit einer Einstellung beendeten Gerichtsprozesses Anfang September und des Leipziger Anwalts von Christopher S., die die Staatskasse trägt, konnten nicht berücksichtigt werden.
„Wir haben wirklich andere Probleme in Berlin und könnten das Geld für den Ausbau von Prävention und juristischer Verfolgung von Islamismus ver wenden“, kritisierte Schlüsselburg den Verfolgungseifer.
Derweil gehen im Gefahren gebiet der Rigaer Straße die um strittenen und kostenintensiven Polizeimaßnahmen weiter. So rückte vor weniger Tagen die Polizei mit Feuerwehr und Beweissicherungstrupp an, um ein Transparent von der Fassade der Rigaer Straße 94 zu entfernen, weil es das Logo der linken On lineplattform indymedia zeigte. Doch auch nach dem Verbot von indymedialinksunten ist das Zeigen des Symbols bisher nicht strafbar.
aus Taz: 13.10.2017
Peter Nowak
Die Anti-Knast-Tage in Berlin beleuchteten die Situation der Gefangenen nach den Hamburger G20-Protesten
Bei vielen libertären Linken ist kooperatives Verhalten mit Gerichten oder anderen Staatsorganen nicht gerne gesehen. So stößt das Einlenken vieler junger G20-Häftlinge nicht bei allen auf Verständnis.
Die juristische Nachlese der Proteste gegen den G20-Gipfel ist im vollen Gange. Die ersten elf Angeklagten vor dem Hamburger Amtsgericht haben die ihnen vorgeworfenen Taten eingeräumt, um Entschuldigung gebeten und nahmen das Entgegenkommen der Gerichte dankbar an, wenn diese – wie in vielen Fällen geschehen – die von der Staatsanwaltschaft geforderten hohen Strafen zur Bewährung aussetzten.
Doch immer noch sitzen seit Anfang Juli rund 30 Personen im Knast – die meisten von ihnen in Untersuchungshaft. Unter ihnen der 21-jährige nicht vorbestrafte Niederländer Peike S., der wegen zweier Flaschenwürfe auf Polizeibeamte zu einer ungewöhnlich hohen Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten ohne Bewährung verurteilt worden war.
Bei vielen Hamburger G20-Häftlinge können Gemeinsamkeiten ausgemacht werden. Oft sind die Beschuldigten recht jung, leben im europäischen Ausland und arbeiten in geregelten Arbeitsverhältnissen. Ihr größter Wunsch ist es, das Gefängnis und Deutschland zu verlassen. Um ihre Gerichtsprozesse zu verkürzen, kooperieren sie mit den Behörden.
Über die Repressionsbedingungen wurde am vergangenen Wochenende auf den Anti-Knast-Tagen im Berliner Mehringhof debattiert. Ein Bündnis verschiedener libertärer Gruppen hatte ein vielfältiges Programm vorbereitet, an dem auch Vertreter_innen aus den Reihen der Zeitschrift »Gefangeneninfo« und der »Roten Hilfe« teilnahmen. Insgesamt waren über 200 Besucher_innen aus Deutschland und Österreich angereist, sie setzten sich zwei Tage lang mit den unterschiedlichen Aspekten von Gefängnis auseinander.
Vielen auch in der radikalen Linken sei heute oft nicht klar, dass eine Demonstration mit Gefängnis enden kann, so der Tenor. Das schaffe Ängste und führe dann dazu, dass die Betroffenen nur noch darüber nachdenken, wie sie schnell wieder aus dem Gefängnis entkommen können. So zumindest erklärten sich die meist jungen Teilnehmer_innen der Tagung die große Bereitschaft zur Kooperation bei den Hamburger Gerichtsverfahren. Ein junger Mann sprach auch von einer Niederlage für die außerparlamentarische Linke.
Wolfgang Lettow gehörte zu den älteren Teilnehmern der Anti-Knast-Tage. Der Redakteur der Zeitschrift »Gefangeneninfo« hat bereits Ende der 1970er Jahre mit der Solidaritätsarbeit begonnen, als Gefängnisse noch voll mit politischen Gefangenen und die Gerichtssäle zu klein für die vielen Prozessbesucher_innen waren.
In seinen Vortrag ging er auf die heute im Vergleich zu den 70er und 80er Jahren stark veränderte soziale Zusammensetzung in den deutschen Gefängnissen ein. Neben Menschen aus der Türkei und Kurdistan, die heute das Gros der politischen Gefangenen stellen, säße auch eine steigende Anzahl sogenannter sozialer Gefangener aufgrund von Delikten wie Schwarzfahren, Diebstahl oder Raub ein. Beide Gruppen seien besonders starken Disziplinierungsmaßnahmen ausgesetzt, wenn sie im Gefängnisalltag zu wenig Kooperationsbereitschaft zeigen würden. Lettow betonte, dass Briefe für Gefangene nach wie vor ein wichtiges Mittel der Unterstützung seien.
Großen Raum nahm bei den Anti-Knast-Tagen die Frage des Umgangs mit Angeklagten ein, die vor Gericht kooperieren, ohne andere Personen zu belasten. Zu einer gemeinsamen Handlungsmaxime kam man dabei allerdings nicht.
Ein aktueller Fall ist die Verurteilung der Schweizerin Andrea N. vergangene Woche in Chur. Wegen linkspolitisch motivierter Militanz in den Jahren 2007 bis 2010 in Berlin wurde sie zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt, von der sie – abzüglich ihrer in der Untersuchungshaft verbrachten Zeit – nun neun Monate absitzen muss. Die Frau hat sich mittlerweile von der linken Szene verabschiedet und die Anklagepunkte eingeräumt. Gleichzeitig verweigerte sie jedoch Angaben zu anderen Personen und zu politischen Strukturen.
Dennoch hegte von den Anwesenden kaum jemand mehr solidarische Gefühle gegenüber der ehemaligen Berliner Aktivistin Andrea N. Diese hatte bereits vor zehn Jahren wegen politischer Delikte 14 Monate in der Haftanstalt Berlin-Pankow absitzen müssen. Von denen, die damals die Solidaritätskampagne »Freiheit für Andrea« mitgetragen hatten, waren nur noch wenige am letzten Wochenende dabei.
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1066477.zu-kooperativ-fuer-solidaritaet.html
Peter Nowak
——————————————————————————-
In dem Gefangeneninfo und auf der Seite von ABC Wien gab es eine Reaktion auf dem Artikel, der hier nur mit zwei Anmerkungen dokumentiert wird:
Hier ist davon die Rede, dass die Vorbereitungsgruppe so radikal ist, dass sie nicht mit der bürgerlichen Presse kooperiert. Was nicht stimmt. Wenn ein/e Gefangene einen Hungerstreik macht etc. wird natürlich der Kontakt zur Presse gesucht, was ja auch sinnvoll für die Gefangenen sein kann. Nur hat in diesen Fall gar keine Kooperation zwischen den Veranstalter_innen und der bürgerlichen Presse stattgefunden. Das ist nämlich eine längere Zusammenarbeit, die mit Interviews, Artikeln etc. begleitet wird. Das gab es nicht. Ich habe als Journalist über eine öffentlich beworbene und angekündigte Veranstaltung einen Artikel geschrieben. Das ist keine Kooperation zwischen den Veranstalter_innen und der Zeitung und daher haben die Veranstalter_innen darauf auch keinen Einfluss. Es gab natürlich immer wieder Versuche aus verschiedenen politischen Lagern, Berichterstattung zu verhindern. Es ist bedauerlich, dass auch libertäre Linke nicht vor dem Versuchen gefeit sind, eine Berichterstattung, die nicht von ihnen genehmigt ist und nicht unter ihrer Kontrolle steht, verhindern zu wollen. Es ist auch bezeichnend, dass ausgerechnet libertäre Linke nicht die Autonomie der Veranstalter_innen der einzelnen Arbeitsgruppen respektieren und auch dort Einfluss nehmen wollen. Den Veranstalter, den ich namentlich erwähnte, habe ich vorher gefragt und er hat seine Zustimmung dazu gegeben. Dass sich da noch einige sogenannte Libertäre als Über-ZK aufspielen, ist nur lächerlich. Das Ganze wird hier auch dokumentiert als Zeugnis der ideologischen Verwirrunung heutiger Linksradikaler, die sich ärgern, dass sie nicht alles unter ihrer Kontrolle haben. Und nun ist nicht zu befürchten, dass diese in ihrer aktuellen Form als radikale Linke mehr Einfluss auf die Gesellschaft bekommen, um ihren Kontroll- und Überwachungsgelüsten zu frönen. Doch zu befürchten ist, dass sie das nach ihrer radikalen Phase tun, wenn sie dann in den diversen Jobs für die bürgerliche Gesellschaft sind.
Die Anti-Knasttage 2017 in Berlin
Eine Auswertung, wie sie waren, was fehlte, wie geht es weiter?
Die Orgagruppe der Anti-Knast-Tage 2017
aus: gi_411_web.pdf und
Die Anti-Knast-Tage 2017 in Berlin – Eine Auswertung, wie sie waren, was fehlte, wie geht es weiter?
„Bei wem wir uns auch sehr ausdrücklich bedanken wollen, ist der Journalist Peter Nowak. Dieser nämlich veröffentlichte einen Artikel in der Zeitung „Neues Deutschland“, „Zu kooperativ für Solidarität?1“ über die Anti-Knast-Tage in Berlin. Wir wollen mal ein paar Dinge klarstellen, erstens, die Anti-Knast-Tage waren nicht von einem „ Bündnis verschiedener libertärer Gruppen“ organisiert und es nahmen auch keine „Vertreterin*innen aus den Reihen (…) der Roten Hilfe“ teil. Einige von uns sind Anarchist*innen, aber andere eben nicht und wir wollen dies betonen. Die Rote Hilfe wurde nicht eingeladen, weil sie nicht für die Abschaffung der Knäste stehen kann und steht, dies bestätigten uns auch einige ihrer Mitglieder. Diese Einstellung teilen nicht alle Mitglieder der RH, weil es auch dort Menschen gibt, die für die Abschaffung von Knästen sind, aber unter dem Motto könnten sie die Tage nicht unterstützen. Genauso wenig ist die RH für die Freiheit aller Gefangenen und engagiert sich nur für „politische Gefangene“, was wir nicht teilen. Was nicht bedeutet, dass die Rote Hilfe nicht trotzdem einen Infotisch ab dem Samstag aufgebaut hatte und es auch klar war, dass sie dafür Platz hätten.
Was uns auch sehr ärgerte ist das Peter Nowak, einen Veranstalter namentlich erwähnte. Und zuletzt die Einschätzung von Peter Nowak, dass während der Anti-Knast-Tage „die Frage des Umgangs mit Angeklagten (…), die vor Gericht kooperieren“ sehr viel Raum eingenommen hätte. Um diese Frage herum fand eine Veranstaltung statt, die von einer sehr langen Diskussion begleitet wurde. Aber es war nur eine von vielen. Dass daraus Peter Nowak die Schlussfolgerung zog, dass dies sich auf den Fall einer Person bezieht die in der Schweiz verurteilt wurde, war mehr als fragwürdig und nicht nachvollziehbar. Unseres Erachtens nach spielte es evtl. nur in kleinen Gesprächen eine Rolle, aber über diesen Fall wurde nicht in den Diskussionen geredet. Wir wollen nicht sagen, dass Peter Nowak absichtlich gelogen hat, aber er hat definitiv nicht wenig falsch veröffentlicht. Er hat auch in keinem Moment mit irgendwem von uns geredet, bzw. erwähnt, dass ein Artikel veröffentlicht werden würde. Dies hätten wir so oder so verneint, weil wir die Kooperation mit bürgerlichen Medien strikt verweigern. Für uns ist es wichtig, dies klarzustellen, weil es uns selber sehr überraschte einen Artikel darüber zu lesen und es uns sehr ärgerte was drin stand. Wir haben Peter Nowak ganz persönlich die Leviten gelesen. Diese Zeilen sollten ihn also auch nicht mehr überraschen.
In Jena war ein der vietnamesischen Regierung nahestehender Mann beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angestellt
Der Bescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im thüringischen Jena/Hermsdorf war für Kanha Chhuns eine große Enttäuschung. Der kambodschanischen Oppositionellen wurde mitgeteilt, dass sie und ihre beiden Kinder innerhalb von 30 Tagen Deutschland verlassen müssen. Ihre Anträge auf Asylanerkennung wurden abgelehnt. Auch der subsidiäre Schutzstatus wurde ihnen nicht zuerkannt. Der Ablehnungsbescheid, der »nd« vorliegt, ist mit Ho unterzeichnet. Das Kürzel steht für Ho Ngoc. T. Der aus Vietnam stammende Mann hat bis vor wenigen Wochen im BAMF in Jena gearbeitet. Ho Ngoc. T. gilt keineswegs als neutral. Er hatte im sozialen Netzwerk Facebook die Entführung eines ehemaligen vietnamesischen Politikers aus Deutschland nach Vietnam zustimmend kommentiert.
Nach Angaben der Flüchtlingsorganisation The Voice war Kanha Chhuns in Kambodscha in der Oppositionspartei CNRP aktiv und nahm an Demonstrationen teil. Die CNRP setzte sich unter anderem für Rechte streikender ArbeiterInnen ein, die von dem kambodschanischen Regime verfolgt werden. Der kambodschanische Langzeitpräsident Hun Sen ist ein enger Verbündeter Vietnams.
Dass ausgerechnet ein Gefolgsmann Vietnams über Asylanträge von kambodschanischen Oppositionellen entscheidet, empört die Flüchtlingsorganisation The Voice. »Wir fordern, dass die politische Verfolgung von kambodschanischen AktivistInnen als legitimer Fluchtgrund anerkannt wird. Das bedeutet auch, dass alle durch Herrn Ho Ngoc T. negativ entschiedenen Anträge noch einmal bearbeitet und entschieden werden müssen«, fordert Bernhard S., der in Thüringen in der Geflüchtetensolidarität aktiv ist. Diese Forderung wird auch von Vu Quoc Dung unterstützt. »Wenn das BAMF Herrn Ho Ngoc T. wegen Verletzung der Neutralitätspflicht entlassen hat, dann müssen nun die Asylfälle von kambodschanischen Oppositionellen, die er entschieden hatte, neu geprüft werden. Denn es ist weitgehend bekannt, dass Herr Ho Ngoc T. die Politik der vietnamesischen Regierung öffentlich verteidigt, deren Schützling der kambodschanische Diktator Hun Sen ist«, erklärt der Direktor der Menschenrechtsorganisation VETO! Human Rights Defenders‘ Network e.V. gegenüber »nd«.
Er erinnerte auch daran, dass sich Ho Ngoc T. in Zeitungen der vietnamesischen Regierungspartei wiederholt abfällig über vietnamesische DissidentInnen geäußert und die Verhaftungen von BloggerInnen und JournalistInnen verteidigt habe. Zudem habe Ho Ngoc T. von der allein regierenden Kommunistischen Partei Vietnam einen Preis für Auslandspropaganda bekommen.
»Grundsätzlich ist die Entscheidung über Asylanträge durch eine Person, die – wie wir jetzt wissen – weit weg vom sogenannten Boden des Grundgesetzes steht, inakzeptabel«, sagte die Berliner Rechtsanwältin Petra Schlagenhauf dem »nd«. Sie hat den entführten vietnamesischen Ex-Politiker vertreten, der in Deutschland Asyl beantragt hat.
Die Sprecherin des BAMF, Kira Gehrmann, bestätige gegenüber »nd«, dass Ho Ngoc T. seit 1991 als Sachbearbeiter beim BAMF beschäftigt, dort aber nicht für die Durchführung von Asylverfahren für vietnamesische AsylbewerberInnen zuständig war. Von den Veröffentlichungen des Mitarbeiters habe ihre Behörde erst durch eine Presseanfrage Anfang August 2017 Kenntnis erlangt.
Danach sei der Mann bis zur endgültigen Klärung des Sachverhalts von seinen Tätigkeiten entbunden worden. Nach Abschluss der Prüfung habe das Bundesamt das Arbeitsverhältnis umgehend beendet. Kanha Chhums und ihre Kinder hatten wohl Pech, dass ihre Ablehnungen schon Anfang August ausgefertigt wurden. Zur Frage, ob die Anträge noch einmal überprüft werden, wollte Gehrmann aus datenrechtlichen Gründen nicht Stellung nehmen.
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1065679.zustaendig-fuer-auslandspropaganda-und-asylentscheide.html
Peter Nowak
Beamte sollen bei Kontrollen in der Rigaer Straße eine Passantin verletzt haben
BewohnerInnen des Friedrichshainer Nordkiezes erheben schwere Vorwürfe gegen die Polizei. In einer Pressemitteilung, die mit „Nachbar_innen im Nordkiez Friedrichshain“ unterschrieben ist, wird die Polizei beschuldigt, am Sonntagnachmittag für den Sturz einer Frau vom Fahrrad verantwortlich zu sein. Sie habe sich dabei am Rücken verletzt und sei im Klinikum Friedrichshain stationär behandelt worden.
Der taz schilderte die verletzte Radlerin Gudrun G., die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, die Vorgeschichte. Sie sei am Sonntag auf dem Weg zu einem Hoffest des linken Hausprojekts Rigaer Straße 94 gewesen. Laut Einladung waren alle „FreundInnen des Hauskollektivs“ gebeten, „mit uns zusammen zu schlem- men, Broschüren durchzublättern, vielleicht einen Workshop zu besuchen, die Köpfe zusam- menzustecken und sich bei Musik die Hände an der Feuertonne zu wärmen“.
Das wollte auch G., die in einer Nachbarschaftsinitiative aktiv ist, die auf dem Fest ihre Arbeit vorstellte. Doch das war gar nicht so leicht, wie BesucherInnen bestätigen. Der Grund waren massive Personenkontrollen rund um das Haus. „Ich stellte die rechtliche Grundlagen dieser Durchsuchungen infrage und erinnerte die PolizistInnen daran, dass darüber vor Gericht gestritten wird“, erklärt G.
Klage vor Gericht
Hintergrund ist die Klage mehrerer von Polizeikontrollen Betroffener vor dem Verwaltungsgericht. Mitte September begannen die Verhandlungen. Dabei soll geklärt werden, ob die Klassifizierung der Gegend rund um die Rigaer Straße zum kriminalitätsbelasteten Ort rechtmäßig ist. Darauf bezieht sich die Polizei bei ihren Personenkontrollen.
Doch für ihre Bedenken fand Gudrun G. bei der Polizei am Sonntagnachmittag kein Gehör. Die zuständige Einsatzleiterin erteilte ihr einen Platzverweis, dem sie nachkam. Trotzdem sei sie auf dem Nachhauseweg in der Cellestraße erneut von der Polizei angehalten worden. „Ein Polizist griff in den Lenker meines Fahrrads, sodass ich stürzte. Ich hatte starke Rückenschmerzen und konnte nicht mehr auf- stehen“, erklärt G. Im Krankenhaus bekam sie schmerzlin- dernde Spritzen. G. habe die Polizei darauf hingewiesen, dass sie wegen eines Bandscheiben- vorfalls in Behandlung sei, bestätigten AugenzeugInnen des Vorfalls der taz.
Ein Polizeisprecher bestätigte am Dienstag, dass der Fall intern geprüft werde. Wegen des Feiertags könne die Pressestelle aber vor Redaktionsschluss keine Stellungnahme abgeben.
aus taz vom 4.10.2017
Peter Nowak
Die Stadtverwaltung in Dresden will härter gegen Bettler vorgehen. Linke Organisationen haben deshalb die »Bettellobby Dresden« gegründet. Maja Schneider von der Gruppe »Polar«, die dem Bündnis angehört, hat mit der Jungle World gesprochen.Warum brauchen Bettelnde in Dresden eine Lobby?
Es gab vor allem in den lokalen Zeitungen Berichte über und vor allem gegen das Betteln. Oft spielten die Artikel mit Vorurteilen. Vor allem die Behauptung, dass Kinder zum Betteln instrumentalisiert würden, erregte die Gemüter. Die Kommentare zeigten, dass Ressentiments gegenüber Roma ein wichtiger Bestandteil dieser Debatte sind. Fakten, beispielsweise darüber, wie viele Familien überhaupt in der Stadt betteln, gab es kaum. So wurde das Betteln zum Problem aufgebauscht. Daraufhin begann die Verwaltung, über mögliche Verbote zu diskutieren.
Was ist Ihr Ziel?
Zuerst wollen wir Bettelverbote und die Gängelei von Bettelnden verhindern. Denn Bettelverbote machen nicht satt; sie vertreiben Arme aus der Stadt oder machen ihre Tätigkeit illegal. Wir wollen außerdem über den Rassismus gegen Sinti und Roma aufklären, der ganz oft in Debatten über Armut eine Rolle spielt. Einerseits sind viele Roma von Armut betroffen, weil sie in ganz Europa diskriminiert werden. Andererseits betteln nicht alle Roma, sondern arbeiten beispielsweise auch als Ärzte, Lehrer, Handwerker.
Sollte eine emanzipatorische Linke nicht die Verhältnisse kritisieren, anstatt die Aufrechterhaltung des Bettelns zu fordern?
Wir engagieren uns auch gegen die kapitalistischen Verhältnisse, die Menschen zum Betteln zwingen. Wie viele politische Gruppen haben wir unterschiedliche Themen und arbeiten in unterschiedlichen Bündnissen. Es gibt unserer Meinung nach viele gute Gründe für eine Bettellobby, auch für emanzipatorische Linksradikale. Erstens selbstverständlich die Solidarität: Solange es Armut gibt, müssen Arme das Recht haben, in der Stadt sichtbar zu sein und zu betteln. Niemand will über Armut sprechen, wir schon. Zweitens glauben wir nicht an all or nothing von heute auf morgen. Der Kapitalismus wird morgen nicht zugunsten eines solidarischen Entwurfs abgeschafft worden sein.
Was bedeutet Ihre Parole »Betteln ist ein Recht auf Stadt«?
Bettelverbote verstoßen gegen Grundrechte. Jede und jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern, was auch bedeutet, über eigene Nöte zu sprechen und um Hilfe zu bitten. Als emanzipatorische Linke sollten wir Grundrechte verteidigen. So ist der Kampf gegen Bettelverbote auch einer gegen autoritäre Verschärfungen in der Politik wie Kontrolle, Schikane, Verächtlichmachung und Verdrängung. Solche Debatten und Vorgehensweisen können wir nicht einfach stehen lassen. Wir machen das Recht auf Stadt, auf Bildung und volle Bewegungsfreiheit für alle geltend.
Welche Rolle spielt Rassismus in der Debatte?
Ginge es um deutsche Bettelnde, würde niemand über ein Bettelverbot reden. Die Artikel und Kommentare in der lokalen Presse entspringen antiziganistischen Vorstellungen. Deshalb arbeiten wir sehr eng mit Romano Sumnal zusammen, der ersten Selbstvertretung von Roma in Sachsen. Außerdem ist die Treberhilfe in Dresden unsere Partnerin. Sie unterstützt arme Menschen und protestiert immer wieder gegen diese rechte Argumentation.
https://jungle.world/artikel/2017/39/bettelverbote-machen-nicht-satt
Interview: Peter Nowak
Die linke Informationsplattform «linksunten.indymedia» wurde im Zuge der Repression nach dem G20-Gipfel abgeschaltet. Die Plattform selber hat sich in ihrer Funktion und in ihrer Bedeutung während den letzten Jahren stark verändert.
«Rote Karte für den schwarzen Block! Linksterror stoppen», steht auf einem Wahlplakat, mit dem sich die rechtspopulistische AfD als Law-and-Order-Partei profilieren will. Doch damit unterscheidet sie sich kaum von der grossen Koalition aus CDU/CSU, FDP und SPD, die nach den militanten Auseinandersetzungen beim G20-Gipfel die letzten Reste von politischem Widerstand bekämpfen.Nicht nur linke Zentren wie die Rote Flora in Hamburg sollen kriminalisiert werden. Der Schlag gegen die Plattform «linksunten.indymedia» gehört dazu. Dabei musste erst ein Verein konstruiert werden, um dann gegen ihn vorzugehen. Am 25. August 2017 durchsuchte die Polizei auf Weisung der Bundesinnenministeriums in Freiburg mehrere Räumlichkeiten und Wohnungen. Ziel war die Durchführung des Verbots der Informationsplattform «linksunten.indymedia», die seitdem abgeschaltet ist.
Dass der Repressionsschlag mit den militanten Auseinandersetzungen in Hamburg begründet wird, zeigt einmal mehr, wie sehr es das politische Establishment geärgert hat, dass in Hamburg deutlich geworden ist, dass Deutschland kein ruhiges Hinterland ist, wenn es die Mächtigen aus aller Welt empfängt.
Nicht linksextrem
Indymedia war keine Plattform der radikalen, sondern der globalisierungskritischen Linken. Doch die Vorbereitungen des Verbots gegen den konstruierten Indymedia-Verein begannen schon vor den G20-Protesten in Hamburg. Es handelt sich auch um keinen Schlag gegen die radikale Linke, wie es nach dem Verbot viele MedienvertreterInnen voneinander abschreiben. Wer in der letzten Zeit einmal die Seite studiert hat, konnte feststellen, dass dort Berichte über eine ganze Palette von politischen Aktionen ausserhalb der Parlamente zu finden waren. Ob es Mietendemos, Kundgebungen gegen Sozialabbau oder die Organisierung eines Infostands gegen die AfD war. All diese Aktionen kamen bei «linksunten.indymedia» vor. Die Voraussetzung dazu war, dass die Berichte von den AktivistInnen selber verfasst wurden. Manche schrieben anonym, doch zunehmend wurden auch Artikel mit Klarnamen verfasst und manchmal waren sogar E-Mail-Adressen und Telefonnummern unter den Beiträgen zu finden. Daraus wird deutlich, dass Indymedia eine Plattform für ausserparlamentarische Politik in all ihren Formen war. Den Schwerpunkt nahm dort die Berichterstattung über gewaltfreien Protest der Nichtregierungsorganisationen ein und manchmal tauchten auch Berichte über militante Aktionen auf. Doch die waren so selten, wie sie es in der politischen Realität in Deutschland tatsächlich auch sind.
Wenn nun «linksunten.indymedia» unisono als Plattform der LinksextremistInnen verschrien wird, zeigt das nur, dass die VerfasserInnen solcher Einschätzungen die Seite nicht kennen. Für die radikale Linke war die Plattform in der letzten Zeit nicht besonders interessant, weil eben klar war, dass sie nicht nur von den Geheimdiensten eifrig mitgelesen wurden. Unter den VerfasserInnen von Beiträgen waren selber auch GeheimdienstmitarbeiterInnen. Zudem sorgten noch die Internettrolle, die durch solche Seiten angezogen werden, dafür, dass Indymedia an Bedeutung verloren hat. Denn dadurch waren Diskussionen auf «linksunten.indymedia» über in der Linken strittige Themen wie die Haltung im Israel-Palästina-Konflikt nicht möglich, womit die Plattform als Medium der Diskussionsplattform ausschied. Sie war damit nur noch eine reine Informationsplattform.
Repression und Solidarität
Der Repressionsschlag hat erst manche Linke wieder darauf hingewiesen, dass es Indymedia noch gibt. In der 18-jährigen Geschichte von Indymedia gab es in den verschiedenen Ländern immer wieder Repression, Hausdurchsuchungen, Beschlagnahme von Computern und die Abschaltungen der Seiten. Berühmt-berüchtigt war der Angriff schwerbewaffneter Polizeieinheiten auf Indymedia-VertreterInnen und viele andere GlobalisierungskritikerInnen am 20. Juli 2001 in Genua. Auch dieser Repression gingen Massenproteste gegen das dortige G8-Treffen voraus. Danach wurde unter anderem die Diaz-Schule am Rande von Genua von der Polizei angegriffen, in der auch Indymedia gearbeitet hat. Damals war die Plattform für diese Bewegung und ihre Organisierung noch sehr wichtig.
Indymedia wurde 1999 von GlobalisierungskritikerInnen gegründet und verbreitete sich schnell auf alle Kontinente. Es war der Beginn eines kritischen Medienaktivismus, der auch die Bedeutung von Medien auf Demonstrationen massiv veränderte. Noch bis in die 1990er Jahre hatten beispielsweise FotografInnen auf linken Demonstrationen einen schweren Stand. Die AktivistInnen wollten nicht fotografiert und gefilmt werden, um sich vor der Repression zu schützen. Heute sind auch fast auf jeder linken Protestaktion mehr Kameras als Transparente zu finden und sie werden auch bedient. Indymedia entstand in einer Zeit, als sich diese Entwicklung abzuzeichnen begann. Bei jedem Gipfelprotest seit 1999 bauten Indymedia-AktivistInnen Computernetzwerke auf und sorgten so dafür, dass die AktivistInnen global kommunizieren konnten. Heute, wo fast alle mit Laptops und Smartphones ausgestattet sind, ändert sich die Rolle dieser MedienaktivistInnen. Sie werden aber nicht überflüssig, wie die wichtige Arbeit des alternativen Medienzentrums FC MC während der G20-Proteste in Hamburg zeigte. Heute verfügt Indymedia weltweit über regionale Ableger. Die jetzt abgeschaltete Plattform gehört dazu. Wenn nun behauptet wird, sie habe nichts mit dem weltweiten Indymedia-Netzwerk zu tun, ist das falsch.
Mehr als ein Strohfeuer?
Jeder regionaler Indymedia-Ableger arbeitet selbständig. Es gibt keine zentrale Steuerung, aber es gibt Grundsätze wie die Konzentration auf den Kampf ausserhalb der Parlamente, die die Leitschnur für die Arbeit der Plattform abgab. Der Angriff auf einen Indymedia-Ableger wird als Angriff auf die Indymedia-Strukturen in aller Welt begriffen, sodass der Repressionsschlag gegen «linksunten.indymedia» auch weltweit Beachtung fand und zu Protest führte. Selbst in den USA solidarisierten sich Gruppen mit der abgeschalteten Seite. Solidaritätsstatements in Deutschland sind unter anderem vom Blockupy-Netzwerk und der Interventionistischen Linken verfasst worden. «Wir sind alle linksunten», lautet der Tenor der Erklärungen.
Angesichts des Verbots werden wieder Diskussionen über eine gemeinsame Plattform linksunten geführt. Es wird sich zeigen, ob es sich dabei um mehr als um ein Strohfeuer handelt. Auch die Linkspartei sowie einige PolitikerInnen der Grünen und sogar der SPD kritisierten das Verbot von «linksunten.indymedia». Mitglieder der Grünen Jugend monierten, dass damit «eine der wichtigsten Informationsquellen gegen rechte Gewalt» kriminalisiert worden sei. Es ist tatsächlich so gewesen, dass auf der Plattform akribisch recherchierte Berichte über die rechte Szene zu finden waren. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die AfD das Verbot als Erfüllung ihre Forderungen feiert und PolitikerInnen der Grünen, Linken und SPD, die sich mit «linksunten.indymedia» solidarisierten, heftig angriffen.
aus Vorwärts/Schweiz:
Peter Nowak
Während Union und FDP mit der AfD darüber streiten, wer schneller Flüchtlinge abschiebt, musste in Hamburg eine Kandidatin der Linken zurücktreten, weil sie bei Facebook nach Filmen wie Inglourious Basterds gefragt hat
Die Schlagzeile hörte sich an, als würde die Bildzeitung eine AfD-Forderung verbreiten. Doch dann war es der FDP-Vorsitzende Lindner, der sich mit der populistischen Parole „Alle Flüchtlinge müssen zurück“[1] in der Boulevardpresse zitieren ließ.
Im Focus[2] konnte man erfahren, dass es sich um Geflüchtete aus Afghanistan handelt und dass Lindner schon öfter die Union in der Flüchtlingsfrage von rechts kritisiert hatte. Von der Linken kam gleich die Schelte, Linder überhole den AfD-Rechtsaußen Gauland noch von rechts. Dafür bekam Lindner Lob und Anerkennung von der Union und der CSU. Der CDU-Vize Stefan Harbarth freute sich, dass Linder nun das Programm der Union übernommen habe.
Nun vergeht kaum ein Tag, an dem sich die Bildzeitung nicht einem AfD-Sprachrohr gleich geriert. Als in der letzten Woche acht afghanische Migranten in einer Boing-Maschine nach Afghanistan abgeschoben wurden, waren Menschenrechtler und zivilgesellschaftliche Organisationen wie Pro-Asyl entsetzt, wie zu Wahlkampfzwecken mit dem Schicksal von Menschen gespielt wurde.
Die Boulevardzeitung titelte[3]: „Kriminelle aus Deutschland abgeschoben – Hier kommen die Verbrecher in Afghanistan an.“ Vorher lautete die Schlagzeile schon „Abschiebeflieger voller Sextäter“. Der rechtspopulistische Einschlag ist selbst von einschlägigen Medien kaum zu toppen. Diese fast tägliche Propaganda von Bild und Co ist Ausdruck eines rechten Diskurses im Wahlkampf, wo Abschiebungen von Flüchtlingen ein zentrales Thema sind.
Es spielte auch beim sogenannten Kanzlerduell eine wichtige Rolle. Hier wurden der AfD die Stichworte geliefert. Es sieht manchmal so aus, als bestünde der Großteil des Wahlkampfes darin, dass die AfD die Fragen stellt und alle anderen Politiker antworten. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich die Rechtspartei in den Umfragen wieder auf ein zweistelliges Ergebnis hochgearbeitet hat.
Wenn ein AfD-Politiker zum Experten linker Gewalt wird
Neben dem Kampf gegen Flüchtlinge und den Islam hat die AfD den Kampf gegen die Linke zu ihrem zentralen Wahlkampfthema gemacht. Es gibt dazu mehrere Motive. Und genau in dieser Zeit bekommt sie eine Art Gratiswerbung vom ZDF. „Radikale Linke – die unterschätzte Gefahr“[4] lautet der Titel einer ZDF-Sendung in der letzten Woche.
Als wissenschaftlicher Experte zum Thema linke Gewalt kommt mit Karsten Dustin Hoffmann ein Burschenschaftler und AfD-Politiker zu Wort. Bemerkenswert ist, dass damit ein Reporter den Rechten eine Bühne bereitet, der für Recherchefilme über das rechte Spektrum bekannt ist[5] und sich damit einen guten Namen gemacht hat, und deshalb auch linke Aktivisten wie Bernd Langer für die Mitarbeit an dem Beitrag[6] gewinnen konnte. Langer war vom Resultat ( „demagogischer Film“, „Propagandafilm“, „ZDF-Feindpropaganda“[7]) überrascht.
Frage nach „antideutschen Filmempfehlungen“ – Linke zum Rücktritt aufgefordert
Während sich FDP, Union und AfD darum streiten, wer das Copyright auf eine Politik hat, in der in jeden Satz einmal das Wort „Abschieben und Sextäter“ vorkommt, musste in Hamburg die 24jährige Sarah Rambatz von ihrem Listenplatz bei der Hamburger Linken zurücktreten.
Sie hatte sich nicht am Wettbewerb, wie schiebe ich Flüchtlinge schneller ab, beteiligt, sondern über eine nichtöffentliche Facebookseite nach „antideutsche(n) Filmempfehlungen? & grundsätzlich alles wo Deutsche sterben“ erkundigt[8]. Die Nachricht über Posting verbreitete sich schnell in sozialen und klassischen Medien[9].
Die Junge Freiheit[10] und andere rechten Medien sorgten dafür, dass Rambatz einem Shitstorm ausgesetzt war[11] In der eigenen Partei bekam sie nicht etwa Unterstützung gegen diese rechten Angriffe, sondern wurde dort beschimpft, weil sie die Wahlchancen schmälere.
In der Zeit, in der Rambatz üble Nazidrohungen bekam, hatte der Hamburger Landesverband nichts Besseres zu tun, als ihr zu attestieren, sie vertrete keine linke Position. Der Linken-Politiker Fabio De Masi[12] wollte gar „das kalte Kotzen“ bekommen[13], wenn eine Kollegin nach einem Film fragt, in dem Deutsche sterben.
Linke wie De Masi oder der Hamburger Landesvorstand der Linkspartei, die nicht in der Lage sind, eine junge Kollegin zu unterstützen, die angegriffen wird, weil sie individuelle Filmwünsche geäußert hat und vielleicht Inglourious Basterds[14] sehen wollte, erweisen sich damit als politisch irrelevant und werden der Rechten bestimmt nichts entgegen setzen.
Peter Nowak
https://www.heise.de/tp/features/Rechter-Diskurs-im-Wahlkampf-3834400.html
URL dieses Artikels:
http://www.heise.de/-3834400
Links in diesem Artikel:
[1] http://www.bild.de/politik/inland/christian-lindner/alle-fluechtlinge-muessen-zurueck-53125272.bild.html
[2] http://ww.focus.de/politik/deutschland/bundestagswahlkampf-fdp-chef-lindner-will-fluechtlinge-nach-kriegsende-zurueckschicken_id_7562589.html
[3] http://www.bild.de/regional/duesseldorf/abschiebung/kriminelle-afghanen-abgeschoben-53191416.bild.html
[4] https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/radikale-von-links-die-unterschaetzte-gefahr-102.html
[5] https://www.jungewelt.de/artikel/318330.polizei-marschiert-auf.html
[6] http://www.presseportal.de/pm/7840/3687012
[7] https://www.jungewelt.de/artikel/318330.polizei-marschiert-auf.html
[8] http://meedia.de/2017/09/07/grundsaetzlich-alles-wo-deutsche-sterben-linken-kandidatin-tritt-nach-antideutschem-facebook-post-zurueck/
[9] http://www.taz.de/!5442858/
[10] https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/linken-politikerin-will-deutsche-sterben-sehen
[11] https://www.shz.de/regionales/hamburg/hamburger-linken-kandidatin-raeumt-listenplatz-wegen-facebook-post-id17766816.html
[12] http://www.fabio-de-masi.de/
[13] http://www.taz.de/!5442858/
[14] https://www.facebook.com/inglouriousbasterdsinternational/
Dresdens Ordnungsbürgermeister will das Betteln von Minderjährigen unter Strafe stellen
Kaum ein anderes Thema beschäftigt die Dresdner im Moment mehr als die Bettler auf den Straßen rund um den Altmarkt, am Albertplatz und am Schillerplatz“, schreibt[1] die Sächsische Zeitung (SZ). Tatsächlich häufen sich in der sächsischen Regionalzeitung die Beiträge zu dem Thema über bettelnde Kinder und Jugendliche, wobei auch häufig erwähnt wird, dass sie aus Osteuropa stammen. Schon vor einigen Monaten wurde in der Zeitung ein Verbot des Bettelns von Kindern diskutiert[2].
Jetzt will Dresdens Ordnungsbürgermeister mit CDU-Parteibuch, Detlef Sittel[3], mit einer neuen Verordnung, die demnächst im Stadtrat diskutiert wird, das Betteln von Minderjährigen unter Strafe stellen.
„Kein Geld mehr für bettelnde Kinder“
„Wer in Begleitung eines Kindes bettelt oder Kinder betteln lässt“, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Dafür droht bis zu 1.000 Euro Bußgeld“, heißt es in der Vorlage. Vorbild sind Städte wie Berlin oder Essen, wo das Betteln von Kindern ebenfalls bestraft wird.
„Mit dem Erlass der Polizeiverordnung durch den Stadtrat hätten wir eine ergänzende rechtliche Grundlage, das Betteln der Kinder zu kontrollieren“, begründet der Oberbürgermeister die geplante Verschärfung in Dresden in einem Interview[4] mit der Sächsischen Zeitung (SZ). Dass es ihm dabei eher um die Aufwertung der Dresdener Innenstadt als um das Wohl der Kinder geht, wird in dem Interview an mehreren Stellen deutlich:
SZ: Kritiker des Verbots befürchten, die Kinder damit in illegale Tätigkeiten wie Diebstahl oder Prostitution zu treiben.
Sittel: Ich sehe diese Gefahr weniger, vermutlich werden unsere Kontrollen eher eine örtliche Verdrängung in andere Städte zur Folge haben.
SZ: Aber würde denn den Kindern ein Verbot wirklich helfen?
Sittel: Das ist schwer einzuschätzen und hängt von den jeweiligen Familienstrukturen ab. In jedem Fall gehören Kinder nicht auf die Straße, sondern in eine Schule. Kinder brauchen Bildung, nicht Bettelei.
SZ: Wären sozialpädagogische Angebote nicht hilfreich?
Sittel: Zuerst wäre es hilfreich, wenn bettelnde Kinder kein Geld mehr von Passanten bekommen würden, denn dann würde sich das Geschäftsmodell nicht mehr rentieren, und es würden von alleine weniger. Diese Kinder sind allerdings hier in Deutschland nicht schulpflichtig, weshalb wir diesbezüglich über keine Handhabe verfügen.
Interview, Sächsische Zeitung[5]
Sittel ist also selber nicht davon überzeugt, dass den Kindern ein Bettelverbot hilft. Aber er vermutet, dass das Verbot die Bettelnden aus Dresden vertreibt und das scheint auch das Hauptmotiv derjenigen zu sein, die sich jetzt so über die Bettelei in der Dresdener Innenstadt aufregen.
Dass es dabei längst nicht nur um bettelnde Kinder geht, wird schnell deutlich, wenn die Sächsische Zeitung dazu Bilder mit älteren Menschen, die um Geld betteln, zeigt und auch Straßenmusiker zum Problem erklärt. Wenn es dann noch heißt, dass zurzeit kaum ein Thema die Dresdner mehr beschäftigt als das Betteln in der Innenstadt, wird einmal mehr deutlich, dass es sich um eine Projektion handelt.
„Kein Mensch bettelt freiwillig“
Für Gjulner Sejdi[6] vom sächsischen Roma-Verein Romano Sumnal [7] ist diese Argumentation zynisch. Von dem Verbot hält er gar nichts, wie er in einem SZ-Interview[8] erklärte:
Gjulner Sejdi: Ich halte gar nichts von einem Verbot. Statt so etwas mal eben schnell zu beschließen, sollte lieber nach den Ursachen, warum Menschen betteln, gesucht werden und diese dann bekämpft werden.
Sächsische Zeitung: Was sind die Ursachen aus Ihrer Sicht?
Gjulner Sejdi: Kein Mensch bettelt freiwillig, das muss man zunächst klarstellen. Die meisten Familien betteln hier in Deutschland aus Armut.
Sächsische Zeitung: Was würde den Kindern mehr helfen als ein Verbot?
Gjulner Sejdi: Ein Besuch von Schule und Kita. Ein Deutschkurs allein reicht nicht, viele können bereits Deutsch, es fehlt an einer Unterstützung durch Kommune und Staat. Helfen würde ihnen auch, wenn Stadt und Polizei mehr über sie wüssten. Wir würden gern Auskunft dazu geben, wurden aber nicht dazu befragt.
Interview, Sächsische Zeitung[9]
„Betteln ist ein Recht in der Stadt“
Die Rechte der Bettelnden zu stärken ist auch das Anliegen der Bettellobby[10], zu der sich verschiedene linke Gruppen in Dresden nach dem Vorbild eines ähnlichen Bündnisses in Wien[11] zusammengeschlossen haben. „Das Netzwerk solidarisiert sich mit Menschen, die betteln müssen und betont, dass Betteln zu können, die eigene Not zu äußern, ein Menschenrecht darstellt“, heißt es in der Erklärung.
„Bettelverbote machen nicht satt, sie vertreiben Arme aus der Stadt oder machen ihre Tätigkeit illegal. Wir wollen außerdem über den Rassismus gegen Sinti und Rom*nja aufklären, der ganz oft in Debatten über Armut eine Rolle spielt“, erklärt Maja Schneider von der linken Gruppe Polar[12], die Teil der Bettellobby ist, gegenüber Telepolis. Auf die Frage, ob eine emanzipatorische Linke nicht die Verhältnisse kritisieren müsste, die Menschen zum Betteln zwingt, statt eine Bettellobby gründen, antwortete Maja Schneider.
Es gibt unserer Meinung nach viele gute Gründe für eine Bettellobby, auch für eine emanzipatorische Linksradikale: Erstens natürlich die Solidarität. Solange es Armut gibt, müssen Arme das Recht haben, in der Stadt sichtbar zu sein und zu betteln, und somit auch die Armut sichtbar zu machen. Niemand will über Armut sprechen, wir schon.
Zweitens glauben wir nicht an ein „all or nothing“ von heute auf morgen: Der Kapitalismus wird morgen nicht zugunsten eines solidarischen Entwurfs abgeschafft. Drittens: Bettelverbote verstoßen gegen Grundrechte. Jede und jeder hat das Recht seine Meinung zu äußern, was auch bedeutet über eigene Nöte zu sprechen und um Hilfe zu bitten. Als emanzipatorische Linke sollten wir Grundrechte verteidigen. So ist der Kampf gegen Bettelverbote auch einer gegen autoritäre Verschärfungen in der Politik.
Maja Schneider, Gruppe Polar
„Ein Bettelverbot bringt kein Kind von der Straße“
Auch Jan Steinle von der „Gruppe Gegen Antiromaismus“[13], die ebenfalls Teil der Bettellobby ist, kritisiert die Diskussion um bettelnde Kinder.
Um diese Repression gegen Arme zu rechtfertigen wird in der öffentlichen Debatte das Kindeswohl vorgeschoben, obwohl die Situation der Kinder mit einem Verbot noch weiter verschlechtert wird. Im besten Fall werden sie nur aus der Innenstadt verdrängt und verlieren ihren Verdienst. Mögliche Hilfsangebote sucht man in der Debatte jedenfalls vergeblich.
Jan Steinle, Gruppe gegen Antiromaismus
Dabei macht sich die Gruppe durchaus Gedanken um realpolitische Voschläge:
Ein Bettelverbot bringt kein Kind in die Schule. Es verschlechtert ihre Lage und treibt sie schlimmstenfalls in die Illegalität. Um den betroffenen Kindern eine Perspektive zu bieten muss ihren gesamten Familien geholfen werden. Ein Problem ist beispielsweise häufig die Meldeadresse. Wer nicht in Deutschland gemeldet ist, hat keinen Anspruch auf einen Schulbesuch. Ohne Wohnung gibt es außerdem keinen Job und umgekehrt. Das ist ein Teufelskreis.
In Berlin können Kinder von Wohnungslosen beispielsweise an einer zentralen Adresse angemeldet werden, um ihnen einen Schulbesuch zu ermöglichen. Außerdem müssen die Betroffenen dabei unterstützt werden, die Ihnen zustehenden Rechte in Anspruch zu nehmen. Eine grundsätzliche Verbesserung der Lage von bettelnden Kindern ist jedenfalls nicht mit plumpen Populismus und einfachen Lösungen zu haben. Da müssen wir uns schon etwas mehr Zeit nehmen.
Gruppe gegen Antiromaismus
Es ist die Frage, ob die politisch Verantwortlichen auf diese Stimmen der Vernunft hören. Noch steht die Ankündigung, das Bettelverbot für Kinder und Jugendliche bis zum November 2017 zu beschließen. Würde es umgesetzt, würde der gefängnisindustrielle Komplex[14] davon profitieren.
Denn Menschen, die mit Betteln ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, können in der Regel die Geldstrafe nicht zahlen und landen im Gefängnis, wo sie für einen Niedriglohn arbeiten müssen.
https://www.heise.de/tp/features/Brauchen-die-Bettler-in-Dresden-eine-Lobby-3830193.html
Peter Nowak
URL dieses Artikels:
http://www.heise.de/-3830193
Links in diesem Artikel:
[1] http://www.sz-online.de/nachrichten/bettelnde-kinder-auf-den-strassen-3653011.html
[2] http://www.sz-online.de/nachrichten/das-ist-verwahrlosung-3670912.html
[3] http://www.dresden.de/de/rathaus/politik/beigeordnete/gb3.php
[4] http://www.sz-online.de/nachrichten/kein-geld-mehr-an-bettelnde-kinder-3745683.html
[5] http://www.sz-online.de/nachrichten/kein-geld-mehr-an-bettelnde-kinder-3745683.html
[6] http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/festakt-auszeichnung-botschafter/170533/auszeichnung-zum-botschafter-fuer-demokratie-und-toleranz-fuer-gjulner-sejdi
[7] https://www.romano-sumnal.com/
[8] http://www.sz-online.de/nachrichten/kein-mensch-bettelt-freiwillig-3768479.html
[9] http://www.sz-online.de/nachrichten/kein-mensch-bettelt-freiwillig-3768479.html
[10] https://www.addn.me/soziales/bettellobby-will-rechte-von-bettlerinnen-staerken/#more-27819
[11] https://www.bettellobby.at/blog/wien
[12] http://gruppe-polar.org/
[13] http://namf.blogsport.de/antiromaismus/
[14] https://ggbo.de/tag/gefaengnis-industrieller-komplex
Dresden plant Bettelverbot von Minderjährigen – Organisationen kritisieren den Ansatz
«Kaum ein anderes Thema beschäftigt die Dresdner im Moment mehr als die Bettler auf den Straßen rund um den Altmarkt, am Albertplatz und am Schillerplatz», schrieb die «Sächsische Zeitung» (SZ) am Montag. Tatsächlich häuften sich in den vergangenen Wochen in der sächsischen Regionalzeitung die Beiträge über bettelnde Kinder und Jugendliche. Dabei wird meistens deren osteuropäische Herkunft erwähnt. Längst hat das Thema auch die Politik erreicht. Dresdens Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) will mit einer Verordnung, die im November im Stadtrat beschlossen werden soll, das Betteln von Minderjährigen unter Strafe stellen.
«Wer in Begleitung eines Kindes bettelt oder Kinder betteln lässt», begeht eine Ordnungswidrigkeit. Dafür droht bis zu 1000 Euro Bußgeld«, heißt es in der Vorlage. Vorbild sind Städte wie Berlin oder Essen, wo das Betteln von Kindern ebenfalls bestraft wird. In Hamburg und Berlin ist sogar ein generelles Bettelverbot für bestimmte Plätze in der Diskussion.
»Mit dem Erlass der Polizeiverordnung durch den Stadtrat hätten wir eine ergänzende rechtliche Grundlage, das Betteln der Kinder zu kontrollieren«, begründet Detlef Sittel in einem Interview mit der SZ die geplante Verschärfung der Bettelordnung. Das es ihm dabei eher um die Aufwertung der Dresdener Innenstadt als um das Wohl der Kinder geht, wird deutlich, wenn Sittel damit rechnet, dass die Bettler künftig in andere Städte ausweichen. Auf die Frage, ob er glaubt, dass die Verschärfungen den Kindern wirklich helfen, antwortet er: »Das ist schwer einzuschätzen und hängt von den jeweiligen Familienstrukturen ab.« Doch für den Bürgermeister ist wichtig, dass die bettelnden Kinder kein Geld mehr bekommen. »Dann würde sich das Geschäftsmodell nicht mehr rentieren, und es würden von alleine weniger.«
Für Gjulner Sejdi vom sächsischen Roma-Verein Romano Sumnal ist diese Argumentation zynisch. Erhält nichts von dem Verbot. »Kein Mensch bettelt freiwillig, das muss man zunächst klarstellen. Die meisten Familien betteln hier in Deutschland aus Armut«, erklärt er in einem »SZ«-Interview. Statt die Bettler zu bestrafen, müssten die Ursachen gesucht und bekämpft werden, die Menschen zum Betteln zwingt. Auch die Dresdner Stadträtin der Grünen, Tina Siebeneicher moniert, dass zu viel über ein Bettelverbot und zu wenig über die Möglichkeiten gesprochen wird, die Situation bettelnder Menschen zu verbessern.
Die Rechte der Bettelnden zu stärken ist auch das Anliegen der Bettellobby, zu der sich verschiedene linke Gruppen in Dresden nach dem Vorbild eines ähnlichen Bündnisses in Wien zusammengeschlossen haben. »Bettelverbote machen nicht satt, sie vertreiben Arme aus der Stadt oder machen ihre Tätigkeit illegal. Wir wollen außerdem über den Rassismus gegen Sinti und Rom*nja aufklären, der ganz oft in Debatten über Armut eine Rolle spielt«, erklärt Maja Schneider von der linken Gruppe Polar, die Teil der Bettellobby ist, gegenüber »nd«.
Auch Jan Steinle von der »Gruppe gegen Antiromanismus«, die ebenfalls Teil der Bettellobby ist, kritisiert gegenüber »nd« die Diskussion in Dresden. »Um die Repression gegen Arme zu rechtfertigen, wird in der öffentlichen Debatte das Kindeswohl vorgeschoben, obwohl die Situation der Kinder mit einem Verbot noch weiter verschlechtert wird«. Die Gruppe orientiert sich durchaus an realpolitischen Ansätzen. »In Berlin können Kinder von Wohnungslosen beispielsweise an einer zentralen Adresse angemeldet werden, um ihnen einen Schulbesuch zu ermöglichen. Außerdem müssen die Betroffenen dabei unterstützt werden, die Ihnen zustehenden Rechte in Anspruch zu nehmen«, betont Steinle.
Auch die Linkspartei in Dresden setzt in Bezug auf das Betteln auf Prävention statt Repression, betont deren Fraktionsvorsitzender Andre Schollbach. Ob sie aber für oder gegen die Verschärfung der Bettelordnung stimmen werde, sei noch Gegenstand von Diskussionen in seiner Fraktion, betonte der Rechtsanwalt gegenüber »nd«.
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1063575.repressive-symptombekaempfung.html
Peter Nowak
Das Amtsgericht Tiergarten hat am Dienstag das Verfahren gegen den linken Aktivisten Christopher S. eingestellt. Er war beschuldigt worden, im Februar 2016 bei einer Polizeikontrolle im Friedrichshainer Nordkiez durch Flatulenzen eine Polizistin beleidigt und in ihrer Ehre verletzt zu haben. Als Strafe sollte er 900 Euro zahlen. Rechtsanwalt Daniel Werner bezeichnete es gegenüber »nd« als kurioses Politikum, dass die Staatsanwaltschaft und das Gericht das Verfahren überhaupt zugelassen haben.
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1062856.linker-aktivist-musste-keine-geldstrafe-zahlen.html
Peter Nowak