
Noch vor einem Jahr sah alles danach aus, dass die Fontanepromenade 15 zum Gedenkort würde.
„„Das passiert an vielen Orten““ weiterlesenZeitungsartikel des Journalisten Peter Nowak

Noch vor einem Jahr sah alles danach aus, dass die Fontanepromenade 15 zum Gedenkort würde.
„„Das passiert an vielen Orten““ weiterlesen
Monatelang hing am Posttower in der Nähe des Halleschen Ufer ein Transparent, auf dem die CG-Gruppe, der das Gebäude gehörte, Politiker/innen des Berliner Senats und des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg beschuldigte, den Bau von Wohnungen dort zu blockieren. Der Hintergrund der Auseinandersetzung war die Frage, ob der Bezirk bei den Planungen mitentscheiden oder ob ein Investor wie Christoph Gröner von der CG-Gruppe seinen Herr-im-Haus-Standpunkt durchsetzen kann. Nun…
„CG-Gruppe verkauft Postscheckamt an Art-Invest“ weiterlesen
Die Mieter*innenbewegung meldet sich am Samstag mit einer Demonstration gegen den Bebauungsplan Ostkreuz aus der Weihnachtspause zurück. Ein Bündnis aus Gewerbetreibenden, Anwohner*innen und Vertreter*innen der Clubkultur rund um die Rummelsbucht ruft dazu auf. „Statt günstigem Wohnraum,…
M99, der Gemischtwarenladen mit Revolutionsbedarf, ist umgezogen. Das sorgt für ganz neue Probleme
„HG und M99 bleiben“, lautete die Parole, mit der Berliner Linke bis zum Sommer 2017 gegen die Vertreibung des Gemischtwarenladens mit Revolutionsbedarf aus der Manteuffelstraße 99 – daher der Ladenname M99 – in Kreuzberg mobilisierten. Die Zwangsräumung des auf den Rollstuhl angewiesenen Geschäftsbetreibers Hans Georg Lindenau, den alle nur HG nennen, konnte damit verhindert werden. Er fand mit Unterstützung der Stiftung Umverteilen und von solidarischen NachbarInnen ein neues Domizil in der Falckensteinstraße 46. Im Juli 2017 war der Umzug abgeschlossen.
Gleich am Eingang werden die BesucherInnen über die Geschichte des Ladens und den Kampf um den Erhalt informiert. Das sei auch dringend nötig, meint HG. Denn obwohl das neue Geschäft nur wenige Hundert Meter vom alten Standort entfernt ist, habe sich die Laufkundschaft sehr verändert. „Von der Berliner linken Szene bekomme ich hier kaum etwas mit. Dafür besuchen mich TravellerInnen aus aller Welt“, meint HG.
Gerade hat er einigen jungen Leuten auf Englisch erklärt, welche T-Shirts er im Sortiment hat. Eine Frau fragt auf Spanisch nach Postkarten, hat aber nichts Passendes gefunden. Das passiert häufiger. Doch HG ist zuversichtlich, in Zukunft mehr Waren anbieten zu können, die die neue Kundschaft interessiert.
Das ist auch nötig, damit HG den Laden auf Dauer halten kann. Schließlich komme er zurzeit schon mal auf Tageseinnahmen unter 100 Euro. „Das Weihnachtsgeschäft fällt in diesem Jahr aus“, konstatiert HG. Das sei am alten Standort noch anders gewesen. „Da kamen auch Menschen, die in der Oranienstraße ihre Einkäufe tätigten, und kauften bei mir die Geschenke für ihre Kinder. Bis zum neuen Laden ist es ihnen wohl zu weit“, analysiert HG das veränderte KundInnenverhalten.
Der neue Standort neben Clubs, Konzert-Location und Kneipen führt aber auch zu ganz neuartigen Problemen. Schon dreimal wurden die Ladenfenster durch Steinwürfe beschädigt. Am vergangenen Sonntagmorgen flog erneut ein Stein durch die Scheibe. Das große Loch ist notdürftig überklebt. Denn für eine neue Scheibe fehlt HG das Geld.
Über die Verantwortlichen und ihre Gründe mag der Ladenbesitzer ebenso wenig spekulieren wie über die Frage, ob der M99 vielleicht jemandem ein Dorn im Auge sein könnte. „In der Gegend um die Oberbaumbrücke gibt es viele Verrückte, die werfen Fahrräder in geparkte Autos. Die smashen auch eine Scheibe, wenn sich die Gelegenheit ergibt.“
Einschüchtern lässt sich HG dadurch nicht. Schließlich ist er als Ladenbesitzer für Revolutionsbedarf Stress gewöhnt. Jahrelang wurde er immer wieder Ziel von Razzien der Polizei, die bei ihm Druckschriften wie die Autonomenpublikation radikal wegen angeblich gewaltverherrlichender Inhalte beschlagnahmte.
Die letzte Durchsuchung liegt mittlerweile schon einige Jahre zurück. Damals versammelten sich oft in kurzer Zeit Menschen aus der Nachbarschaft zur Unterstützung um den Laden. Daran möchte HG wieder anknüpfen: Im Geschäft hat er ein Mikrofon an einen Lautsprecher angeschlossen. Damit kann er bei drohenden Angriffen die Nachbarschaft aufmerksam machen.
donnerstag, 20. dezember 2018 taz
Peter Nowak
Alles begann mit einem Mitglied der Berliner MieterGemeinschaft, der in Berlin-Tempelhof Flyer für eine Protestkundgebung gegen die Immobilienfirma Deutsche Wohnen verteilte. Barbara Jencik war sofort daran interessiert. Denn auch sie wohnte in einem Haus, das der Deutsche Wohnen gehört. Durch den Flyer hatte sie nun erfahren, dass sich in zahlreichen Berliner Stadtteilen Deutsche-Wohnen Mieter/innen organisieren und vernetzen. Zudem koordinieren sie berlinweit Proteste. Barbara Jencik beteiligt sich nicht nur regelmäßig daran. Sie wollte auch in ihrem Wohnumfeld Mitstreiter/innen gewinnen. „Am Anfang war es sehr mühselig“, berichtet sie MieterEcho online. Viele der Mieter/innen im Block wollten nicht glauben, dass die Deutsche Wohnen die Mieten erhöhen würde. Es waren zunächst nur 9 Personen, die sich in der Wohnung von Frau Jencik trafen und die Mieterinitiative „Bofugeri“ gründete. Die Abkürzung steht für die Straßennamen, in denen sich der Häuserblock befindet, der der Deutschen Wohnen gehört. Es handelt sich um Borussia-, Fuhrmann-, Germania- und Ringbahnstraße. Ein Haus steht in der Straße „Am Tempelhof“, die im Kürzel nicht berücksichtigt wurde.
Der Andrang war so groß, dass nicht alle in den Raum passten
Die kleine Mieter/inneninitiative lud im November mit Unterstützung der LINKEN des Bezirks zu einer Versammlung aller Bewohner/innen des Häuserblocks ins Rudolf-Wissel-Haus und hatte mit dem Termin Glück. Kurz vorher hatten alle Mieter/innen des Blocks ein Schreiben des Bezirksamts im Briefkasten, das sie informierte, dass die Deutsche Wohnen die nötigen Unterlagen für eine Modernisierung der Häuser eingereicht hat. Nun hatten die Mieter/innen Schwarz auf Weiß, dass die Warnungen von Frau Jencik und ihrer Mitstreiter/innen keineswegs aus der Luft gegriffen waren. „Es kamen über 100 Anwohner/innen. Fast passten nicht alle in dem Raum“, berichtet Frau Jencik über die erfolgreiche Versammlung. Dort wurde den Mieter/innen geraten, in die Mietergemeinschaft einzutreten. „Wir wollen vorbereitet sein, wenn es in den nächsten Monaten konkret wird, mit den Plänen der Deutsche Wohnen“, sagt Jencik. Jetzt können sie die nächsten Schritte abwarten. Dass die Deutsche Wohnen druckempfindlich ist, zeigt sich an den Plänen für den Tempelhofer Häuserblock. So kann ein Großteil der geplanten Instandsetzungsmaßnahmen nicht auf die Miete umgelegt werden. Das sieht Jencik als einen Erfolg der berlinweiten Organisierung gegen die Deutsche Wohnen. Seit das Unternehmen im Fokus der Kritik steht, agiert es vorsichtiger. Doch für die Tempelhofer Initiative ist das kein Grund sich zurückzulehnen. Auf den grünen Stadtrat für Bauen und Stadtentwicklung in Schöneberg-Tempelhof Jörn Oltmann ist Jencik nicht gut zu sprechen. Auf die Bitte um Unterstützung kam nur die Antwort, darum müssten sich die Mieter/innen selber kümmern. Das haben Jencik und ihre Mitstreiter/innen nun getan und sind jetzt gut vorbereitet auf die Pläne der Deutschen Wohnen. Auch in Tempelhof muss das Unternehmen mit Widerstand durch die Mieter/innen rechnen.
aus: MieterEcho 04.12.2018
https://www.bmgev.de/mieterecho/mieterecho-online/tempelhofer-mieterinnen-gg-deutsche-wohnen.html
Peter Nowak

Wenn sich Deutschland heute als Weltmeister bei der Aufarbeitung der NS-Verbrechen feiern lässt, wird häufig vergessen, dass in Westdeutschland bis in die 1980er Jahre die NS-Opfer und ihre UnterstützerInnen bekämpft und verleumdet wurden. Wie die wieder in Amt und Würden gelangte ehemalige NS-Beamtenschaft vorging, zeigt die Kampagne gegen den in Österreich geborenen Rechtsanwalt Hans Deutsch.
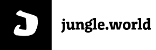
Small Talk von Peter Nowak
Was war der Grund für den Abbruch der Räumung?
Die Polizei hat der Gerichtsvollzieherin keine Vollzugshilfe geleistet, da sich auf dem Gelände Personen befanden, gegen die kein Räumungstitel besteht.

Alexander Kretschmar ist als freier Rechtsjournalist für verschiedene Verbände in Berlin tätig. Zudem ist er Mitglied der Interessengemeinschaft Sozialrecht.
taz: Herr Kretschmar, wer verbirgt sich hinter der Interessengemeinschaft Sozialrecht?
Proteste gegen das Gebaren der Berliner Immobilienfima Padovicz gibt es schon lange. Doch am 25.10. trugen Mieter/innen ihren Unmut direkt vor den Firmensitz von Padovicz am Kurfürstendamm 178/179. Wie viele andere Immobilienfirmen, hat auch Padovicz sein Domizil im noblen Berliner Westen, während er mit der Umstrukturierung von Stadtteilen Profit macht, in denen bisher einkommensschwache Mieter/innen lebten. Der Kampf um die Durchsetzung von Mieter/innenrechten gegen das Profitinteresse von Padovicz hat eine lange Geschichte. Padovicz macht schließlich bereits seit den 90er Jahren als Käufer und Modernisierer ganzer Wohnblöcke von sich reden. Immer wieder wurde auch im MieterEcho darüber berichtet. Dabei legte die Immobilienfirma immer Wert auf gute Kontakte mit Politiker/innen unterschiedlicher Parteien. Eng verknüpft mit dem Berliner Senat, war er einer der großen Profiteure der öffentlichen Sanierungsförderungen im Rahmen des Stadtumbaus der 2000er Jahre. Kommunale Wohnungsbaugesellschaften wie die WBF verkauften ihm für Spottpreise ihre Bestände. Immer wieder wehrten sich auch in der Vergangenheit Padovicz-Mieter/innen erfolgreich gegen ihre drohende Verdrängung. Es gab erfolgreiche juristische Urteile, die den Investorenträumen Grenzen setzten. Doch viele Mieter/innen ließen sich allein durch oft nicht gerichtsfeste Modernisierungsankündigungen abschrecken und zogen aus. Das lag auch an der Vereinzelung vieler Mieter/innen.
Gemeinsam den Entmietungsstrategien trotzen
Doch seit einigen Monaten haben sich Padovicz-Mieter/innen verschiedener Stadtteile vernetzt. Sie wollen gemeinsam den Entmietungsstrategien des Investors trotzen. Mit dem Blog „Padowatch“ haben sie sich ein Forum geschaffen, auf dem sie sich gegenseitig informieren und ihre Proteste koordinieren. Die Kundgebung vor dem Firmensitz ist eine Aktion, mit der Mieter/innen deutlich machen wollen, dass sie dem Investor auch direkt auf die Pelle rücken können. „Auf der Kundgebung soll all denen Raum und ein offenes Ohr geboten werden, die Erfahrungen mit diesem Vermieter sammeln mussten. Diese Geschichten werden öffentlich vorgetragen, damit niemand damit alleine bleibt“, heißt es im Aufruf. Doch beim Erzählen der gemeinsamen Geschichten von Verdrängung und Vertreibung wird es nicht bleiben. Dem Hausprojekt Liebigstraße 34 in Friedrichshain droht zum Jahresende die Kündigung. Der Eigentümer Padovicz weigert sich, die zum 31.12.2018 auslaufenden Verträge zu verlängern. Die Unterstützung für den Erhalt des Hausprojekts wächst. Auch der Zusammenschluss der Padovicz-Koordination ist daran beteiligt. Das ist erfreulich, weil es sich bei der Auseinandersetzung um einen Konflikt zwischen Mieter/innen und Investoren und nicht um den Kampf um ominöse Freiräume handelt. Am Sonntag, den 28.10., soll ab 17 Uhr in den Räumen des Widerstandsmuseums in der ehemaligen Galiläer Kirche in der Rigaer Straße 9/10 der Protest gegen die drohende Räumung der Liebigstraße 34 auf einer Kiezversammlung vorbereitet werden. In der Einladung heißt es: „Der Kampf gegen Gentrifizierung ist eine soziale Bewegung. Dabei geht es nicht nur um ein einzelnes Haus oder Projekt, es geht um Antworten, die kollektiv gefunden werden müssen. Eine nachbarschaftliche Vernetzung ist ein Schritt zu einer solidarischen Selbstorganisierung, die sich außerhalb von Staatlichkeit verortet“.
aus:
MieterEcho online 25.10.2018
https://www.bmgev.de/mieterecho/mieterecho-online/wut-kundgebung-gegen-padovicz.html
Peter Nowak
Mieter/innen und Gewerbetreibende wehren sich gegen Kommerzprojekt an der Rummelsbucht. Dabei haben sie auch die Mehrheit der LINKEN zum Kontrahenten.
Rund um den Bahnhof Ostkreuz in Berlin wird viel gebaut. Auf der Lichtenberger Seite, in der Hauptstraße 1 g-i, konnten bisher einige über 80jährige Wohnhäuser der Abrissbirne trotzen. Doch wie lange noch? Investoren wie Padovicz haben ein Auge auf das Areal zwischen Ostkreuz und Rummelsburger Bucht geworfen. Er hat mehrere sanierungsbedürftige Häuser in der Hauptstraße 1 g – i erworben. Den angegrauten Wänden sieht man an, dass hier lange nicht mehr renoviert wurde. Die Mieter/innen sollen verschwinden. „Die Hausverwaltung kümmert sich schon lange nicht mehr um die Häuser. Selbst das kaputte Dach wird nicht repariert“, klagt Manuela Kaiser (Name auf Wunsch geändert). Sie wohnt seit vielen Jahren in einem der Häuser und will dort auch bleiben. Daher organisiert sie mit einigen Nachbar/innen nicht nur Widerstand gegen die Abrisspläne des Eigentümers, sondern gegen die Bebauungspläne an der Rummelsbucht insgesamt. „Hinter den blumigen Versprechen der Investoren versteckt sich nichts anderes als Verwertung: Hier wird billiger Wohnraum beseitigt und teurer geschaffen“, so ihre Kritik. Die Bewohner/innen haben sich bereits vor Monaten in den Häusern organisiert und auch mit Initiativen aus anderen Stadtteilen sowie dem berlinweiten Blog von Padovicz-Mieter/innen „Padowatch“ vernetzt. Seitdem mehreren sich auch rund um die Rummelsbucht die Proteste. Anfang September gab es eine Ortsbegehung zu Orten von Verdrängung und Protest. Am 18. Oktober richtet sich der Unmut gegen die Bezirksverordnetenversammlung von Lichtenberg. Denn dort soll der Bebauungsplan Ostkreuz beschlossen werden, der nach Meinung der Kritiker/innen einen „Ausverkauf wie in San Francisco“ bedeuten würde.
Tourismusprojekte in der Kritik
Kern des Bebauungsplans Ostkreuz ist die „Coral World“, ein Riesenaquarium. Dabei handelt es sich um einen kommerziellem Entertainment-Aqua-Park, der pro Jahr 500.000 Besucher/innen anziehen soll. Deshalb sollen auch neue Hotels an der Rummelsbucht entstehen. Sollten diese Pläne umgesetzt wären, droht eine Touristifizierung des Areals zwischen Rummelsbucht und Ostkreuz. Wie in anderen Stadtteilen, in denen der rote Teppich für den Tourismus ausgerollt wird, mögen dort neue prekäre Arbeitsplätze entstehen. Doch Menschen mit geringen Einkommen können sich die Wohnungen dort dann nicht mehr leisten. Daher findet das Motto „Bebauung heißt Verdrängung“ viel Zustimmung unter den Mieter/innen und Gewerbetreibenden an der Rummelsbucht. Dabei geht es gegen den Bau von Projekten wie „Coral World“ und Nobelhotels und nicht gegen den Bau von bezahlbaren Wohnungen. Gemeinsam will man den Lichtenberger Bezirksverordneten deutlich machen, dass das Areal um die Rummelsbucht kein Brachland ist, das durch Tourismusprojekte erschlossen werden muss. Besonders für die LINKE, die in der BVV-Lichtenberg stärkste Fraktion ist und mit Michael Grunst den Bezirksbürgermeister stellt, kann die Auseinandersetzung turbulent werden. Während Grunst das Projekt „Coral World“ als gut für den Bezirk lobt, unterstützen einige Mitglieder der Linksfraktion in der BVV die Kritiker/innen. Sie dürften allerdings in der BVV gemeinsam mit den Mitgliedern der Fraktion der Grünen, die den Bebauungsplan Ostkreuz in der bestehenden Form ablehnen, in der Minderheit bleiben. Nun muss sich zeigen, ob die Kritiker/innen mehr Druck von Außen aufbauen können, um eine neue Tourismuszone an der Rummelsbucht zu verhindern.
MieterEcho online 18.10.2018
https://www.bmgev.de/mieterecho/mieterecho-online/coral-world.html
Peter Nowak
Die Mieterbewegung in Berlin wächst, weitere Besetzungen sind geplant
Die steigenden Mieten in Berlin gefährden auch das Kleingewerbe und linke Projekte. Die Protestbewegung wächst und erfasst allmählich auch Künstler, die der Immobilienbranche als unfreiwillige Werbeträger dienen sollen.
n Berlin geht der von der Bewegung »Recht auf Stadt« ausgerufene Herbst der Besetzungen weiter. Wie bei den Besetzungen der vergangenen Wochen sollte auch dieses Mal auf die sozialen Konsequenzen der kapitalistischen Verwertung von Wohnraum aufmerksam gemacht werden. Besonders deutlich wurde das bei der Besetzung der Berlichingenstraße 12 in Moabit. »Hier wurden die teils jahrelang in dem Männerwohnheim wohnenden Bewohner aus dem Haus geworfen, weil mit der Unterbringung von Geflüchteten mehr Geld zu verdienen war. Ein Beispiel von vielen, wie durch die Auslagerung von sozialen Aufgaben an profitorientierte Unternehmen Bedürftige gegeneinander ausgespielt werden«, schrieb die Berliner Obdachlosenhilfe, die die Besetzung unterstützte.
Mehrere Monate lang hatten sich dort Wohnungslose gegen ihren Rausschmiss gewehrt und betont, dass sie sich nicht gegen Flüchtlinge ausspielen lassen wollten. Seit 2017 steht das Gebäude leer. Daran dürfte sich nichts ändern. Nach sechs Stunden räumte die Polizei das Haus, nachdem der Eigentümer Strafantrag gestellt hatte. Die Besetzer sind wütend auf den Berliner Senat, der die Räumung nicht verhindert hat, auch wenn Politiker von Grünen und Linkspartei eine Enteignung des Hauses vorschlugen. Tatsächlich ist die kapitalfreundliche Gesetzeslage der Grund dafür, dass für Menschen mit geringem Einkommen nicht genug Räume zur Verfügung stehen.
eben Mietern sind davon auch immer mehr Kleingewerbetreibende betroffen. So wurden der linken Neuköllner Kiezkneipe »Syndikat« nach 33 Jahren zum Jahresende die Räume gekündigt. Das Haus gehört mittlerweile einer Luxemburger Briefkastenfirma, die einige Wohnungen überteuert mit befristeten Verträgen vermietet. Bereits wenige Tage nach Bekanntwerden der Kündigung äußerte sich Solidarität im Schillerkiez, wo es seit mehreren Jahren eine rege Mieterbewegung gibt. »Mit dem ›Syndikat‹ sollen auch wir Bewohner aus dem Kiez verschwinden, die die Stammgäste in der Kneipe sind«, sagte ein älterer Mann auf einem Nachbarschaftstreffen. Dort sagte auch der Neuköllner Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Jochen Biedermann (Grüne), dass nur öffentlicher Druck das »Syndikat« retten könne. Juristisch gebe es bei einem Gewerbemietvertrag kaum Chancen auf Erfolg.
Die Mieterbewegung in Berlin wächst nach wie vor. So haben sich in der Initiative »Kunstblock and beyond« junge Künstler zusammengeschlossen, die als Zwischennutzer von Gebäuden vor der Sanierung umworben werden. Als solche haben sie keine Rechte und müssen wieder verschwinden, wenn der Umbau beginnt. Dem Ruf als Gentrifizierer wider Willen treten die im Kunstblock kooperierenden Künstler nun entgegen. »Keine Kunststückchen und kein kreatives Kapital mehr für die Finanzialisierung von Stadtraum«, lautet eine Forderung auf einem Informationsblatt, mit dem besonders die Vorgehensweise des Immobilienentwicklers Pandion AG rund um den Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg kritisiert wird.
Wo einst die Autoverleihfirma Robben & Wintjes ihr Domizil hatte, sollten teure Lofts entstehen. Vor Baubeginn gab es einige Kulturevents samt Preisverleihung. Der Kunstblock rief die involvierten Künstler zum Kulturstreik auf. Statt an der Preisverleihung teilzunehmen, sollten sie auf der Straße dagegen protestieren, für Aufwertungsprozesse instrumentalisiert zu werden. Allerdings solidarisierte sich nur der Berliner Künstler Johannes Paul Raether mit dem Anliegen des Kulturblocks.
Für dessen Mitglieder ist das keine Überraschung. Man habe vor dem Eingang viele Gespräche geführt, in denen junge Künstler zwar die Forderungen des Kulturblocks unterstützten. Zugleich seien sie jedoch froh gewesen, dass sie Räume gefunden haben, in denen sie ihre Arbeiten präsentieren können. Denn solche Räume sind im weitgehend durchgentrifizierten Berlin in den vergangenen Jahren knapp geworden. Das nutzen Immobilienfirmen, die wie einst Fürsten und später das liberale Bürgertum als Kunstmäzene auftreten. Der Kunstblock spricht von einer »Artwashing-Kampagne« der Immobilienwirtschaft.
Die auch außerhalb Berlins wachsende Mieterbewegung plant im nächsten Jahr eine bundesweite Demonstration mit gemeinsamen Forderungen an die Politik. Öffentlicher Druck kann vielleicht dafür sorgen, dass einige Gesetze mieterfreundlicher gestaltet werden. Doch die Eigentumsordnung wird dabei sicher nicht in Frage gestellt werden. Daher soll es auch über den Herbst hinaus weitere Besetzungen in Berlin geben.
https://jungle.world/artikel/2018/41/herbst-der-besetzungen
Peter Nowak
Kein Stuhl war mehr frei am frühen Donnerstagabend im Syndikat in der Weise Straße 56 im Schillerkiez in Nordneukölln. Dabei hat es zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht geöffnet. Der Grund für das Treffen: Das Kollektiv der Kiezkneipe hatte zu einer Kiezversammlung geladen. Gemeinsam soll verhindert werden, dass sie zum Jahresende schließen muss. Die Hauseigentümerin, eine Luxemburger Briefkastenfirma, schickte dem Kneipenkollektiv bereits Anfang Juli die Kündigung zum 31. Dezember 2018. Doch noch hoffte man auf Neuverhandlungen. Am 11. September gab es nun überraschend von den Eigentümern eine Absage für Neuverhandlungen ohne Begründung. Doch das Kneipenkollektiv will gemeinsam mit solidarischen Nachbar/innen Druck machen, damit der Mietvertrag verlängert wird. Die große Resonanz des Treffens macht Mut: „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir nicht nur für den Erhalt des Syndikat kämpfen, sondern auch dafür, dass unsere Nachbar/innen im Neuköllner Schillerkiez bleiben können“, erklärte ein Mitglied des Kneipenkollektivs.
Teil einer linken Stadtteilkultur
Das Syndikat hat sich immer als Teil der linken Kiezkultur rund um die Weise Straße verstanden. Enge Kontakte hält das Syndikat mit dem benachbarten Stadtteilladen Lunte. Beide haben ihre Wurzeln in der außerparlamentarischen Linken der 1980er Jahre. Beide waren von Anfang an Orte, in denen Menschen mit niedrigen Einkommen sich treffen können. Gemeinsam organisieren sie jährlich im August mit anderen Nachbarschaftsinitiativen ein Straßenfest, auf dem der Kampf gegen Gentrifizierung in den letzten Jahren eine zentrale Rolle spielte. Nach der Schließung des Tempelhofer Flughafens stand der Schillerkiez in Nordneukölln im Fokus der Gentrifizierung. Nobelrestaurants öffneten und die Mieten stiegen. Auch in der Weise Straße 56 zahlten Studierende mit befristeten Mietverträgen plötzlich das Vierfache der bisher üblichen Miete im Haus. Doch im Schillerkiez gibt es seit vielen Jahren Mieter/innenwiderstand. Mehrere Kiezspaziergänge gegen Verdrängung wurden organisiert, es gab in den letzten Jahren zahlreiche Nachbarschafstreffen. An einer Infowand konnte man sich immer wieder über neue Aktionen informieren. Die Syndikat-Kündigung hat eine Nachbarschaft, die seit Jahren gegen drohende Vertreibung kämpft, erneut mobilisiert. Sogleich wurden auf dem Treffen Arbeitsgruppen gebildet, die Aktionsvorschläge für die Kampagne zum Erhalt des Syndikats erarbeiten. Sie hat schon begonnen: Bereits wenige Stunden nach Bekanntwerden der Kündigung tauchten erste Plakate unter dem Motto „Syndikat bleibt“ auf. „Mit dem Syndikat sollen auch wir Besucher/innen aus dem Kiez verschwinden, die weder Geld noch Interesse an den Nobelrestaurants haben“, sagte ein älterer Nachbar. Das sahen bei der Kiezversammlung viele so. Sie setzten sich nicht für ihre Lieblingskneipe ein, sondern kämpfen für einen Stadtteil, in den sie weiter leben können und wollen.
aus: Mieterecho Online
https://www.bmgev.de/mieterecho/mieterecho-online/syndikat.html
Peter Nowak
Der Friedrichshain-Kreuzberger Baustadtrat Florian Schmidt wird bei einer Versammlung in seinem Bezirk von AktivistInnen niedergebrüllt
Florian Schmidt, Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, gilt gemeinhin als Investorenschreck und Freund von MieteraktivistInnen. Doch dass das nicht überall so ist, diese Erfahrung musste der Grüne am Montagabend im Jugendwiderstandsmuseum im Gebäude der ehemaligen Galiläa-Kirche in der Rigaer Straße in Friedrichshain machen. Eingeladen war Schmidt von der Stiftung SPI, die im Auftrag des Bezirks zu einer Kiezversammlung zum Thema „Der Samariterkiez zwischen Bleiben und Verdrängung“ geladen hatte. Etwa 60 AnwohnerInnen waren gekommen. Doch nicht alle wollten über das Thema Mietenentwicklung reden.„Wir ergriffen sofort das Wort und verhinderten laut, dass die Einladenden zum Zug kamen“, heißt es in einem der taz vorliegenden Bericht der KritikerInnen. Sie monierten die Einla- dungspraxis und vor allem die Verwendung des Begriffs „Kiezversammlung“. „Im Friedrichshainer Nordkiez hat es in den letzten Jahren von den BewohnerInnen selbstorganisierte Kiezversammlungen gegeben.“ Jetzt werde der Begriff für eine Veranstaltung des Bezirks ver- wendet, so die Kritik an die Veranstalter.
Der Baustadtrat versuchte nach der Veranstaltung noch mit einigen der KritikerInnen in Kontakt zu kommen
Das Argument hält Sigmar Gude von der Stadtforschungs-GmbH Asum für plausibel. Er sollte bei der Veranstaltung als Experte für die Maßnahmen gegen Verdrängung von Mietern referieren. Doch dazu kam es nicht mehr. Schmidt sei teilweise so hart und wütend angegangen worden wie sonst konservative Hardliner wie Ex-Innensenator Frank Henkel (CDU), berichtet Gude. Den Grund sieht er auch darin, dass auf Bezirks- und selbst auf Senatsebene wenig im Sinne der MieterInnen entschieden werden könne. Das sei in den 1980er Jahren noch anders gewesen. Damals hätten BewohnerInnen das Gefühl gehabt, sie könnten über ihr Lebensumfeld mitentscheiden.So pessimistisch sieht es Konstanze Fritsch nicht. „Die Veranstaltung hat stattgefunden, aber anders, als wir es geplant hatten“, so das Fazit der Leiterin des SPI-Projekts „Miteinander im Samariterkiez“. Es habe auch TeilnehmerInnen gegeben, die wegen des angekündigten Programms gekommen waren. Es werde auch in Zukunft weitere Veranstaltungen im Friedrichshainer Nordkiez geben, die dann aber nicht mehr Kiezversammlungen genannt werden sollen. „Wir ändern den Namen, aber nicht das Format“, kündigt Fritsch an.
Schließlich kam es auf der Veranstaltung trotz aller Turbulenzen zu keinem Polizeieinsatz. Baustadtrat Schmidt versuchte nach der Veranstaltung noch mit einigen der KritikerInnen in Kontakt zu kommen.
aus: Taz vom 10. oktober 2018
Peter Nowak
Das »Bündnis A100 stoppen« will am Sonntag auf der Kreuzung Elsenstraße/Puschkinallee ab 15 Uhr für eine Stunde den Verkehr stilllegen. Mit der Blockade soll gegen den Weiterbau der Autobahn A100 von Neukölln nach Treptow, Lichtenberg und Friedrichshain demonstriert werden. Seit Jahren wenden sich die A100-Gegner*innen gegen diese Pläne. »Es geht darum, eine neue Mobilität in den Städten zu diskutieren. Dabei kann man von China lernen, wo die Elektromobilität einen zentralen Stellenwert eingenommen hat«, erklärt Tobias Trommer, Sprecher der Initiative, gegenüber dem »nd«.
Anlass für die Protestaktion sind Pläne für die noch in Bau befindlichen Trasse von Neukölln zur Straße Am Treptower Park. Dabei soll nun offenbar eine Rampe über die Ringbahn führen, welche laut Autobahngegner*innen bereits den Weiterbau nach Friedrichshain und Lichtenberg vorbereite. Außerdem würde die Rampe Mehrkosten erzeugen, wodurch die A100-Gegner*innen auch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts verletzt sehen, welches zusätzliche Ausgaben ausschließt.
Von Rot-Rot-Grün fordert die Initiative, die neue Trassenvariante zu verhindern. Wenn der Mitte-links-Senat dies nicht verhindere, ignoriere er die eigene Koalitionsvereinbarung. Diese schließe Planungen für den 17. Bauabschnitt nach Friedrichshain und Lichtenberg aus, was seinerzeit ein Kompromissregelung war. Angesichts der aktuellen Diskussion über Luftverschmutzung durch den Autoverkehr fühlen sich die Gegner*innen bestätigt. Sollte die A100 bis zum Treptower Park verlängert werden, werde der zunehmende Verkehr den Menschen in Alt-Treptow und Friedrichshain »den Platz zum Leben und die Luft zum Atmen nehmen«, so die Initiative.
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1102888.protest-zu-a-flammt-erneut-auf.html
Peter Nowak
Politik Solidarische Wohnungsgenossenschaft Leipzig
In Leipzig versucht eine Gemeinschaft von Enthusiasten, sich ohne Profitinteressen im Wohnungsmarkt zu behaupten
Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Gebäude der Merseburger Straße 38c im Leipziger Stadtteil Lindenau nicht von den Nachbarhäusern. Am unteren Teil der Fassade haben sich Grafittikünstler*innen ausprobiert. Fahrräder lehnen an der Wand. Eine Gruppe jüngerer Leute sitzt an dem sonnigen Herbsttag vor dem Haus. Einige gehören zu den 23 Bewohner*innen des Hauses, das mittlerweile als Merse 38c in Leipzig bekannt geworden ist. Denn es ist eines der beiden Gebäude, mit denen die Solidarische Wohnungsgenossenschaft Leipzig (SoWo) im Kampf um bezahlbare Wohnungen neue Wege geht.
Nach mehrmonatigen Verhandlungen zwischen Mieter*innen und Eigentümerin erzielte man eine einvernehmliche Lösung. Die SoWo kaufte das Haus, und die Mieter*innen übernahmen die Verantwortung. Auch die ehemalige Vermieterin ist Mitglied der Genossenschaft. »So ist es uns gelungen, einen dauerhaften Rahmen für die Gemeinschaft zu schaffen, vor allem aber auch, die Mieten im Haus auf einem sozialverträglichen Niveau von 4,80 Euro pro Quadratmeter zu halten«, sagt Paul Schubenz dem »nd«. Der Handwerker ist vor einigen Jahren von Berlin nach Leipzig gezogen und gehört zu den Mitbegründern der Genossenschaft. Der starke Zuzug nach Leipzig habe zu der Suche nach neuen Formen solidarischen Wohnens beigetragen, erklärt SoWo-Vorstandsmitglied Tobias Bernet. Er forscht als Historiker zur Wohnungs- und Stadtpolitik und ist seit Jahren in der Recht-auf-Stadt-Bewegung aktiv.
Die Zeit des großen Leerstands ist auch in Leipzig vorbei. Damals wurden in vielen Stadtteilen Erfahrungen selbstverwalteten Wohnens gesammelt. Wegen des anhaltenden Bevölkerungswachstums gibt es inzwischen so gut wie keine leeren Häuser zu vernünftigen Preisen mehr. »Andererseits kommen zunehmend die Bewohner*innen in normalen Mietshäusern unter Druck: Gerade in Gebäuden, die nicht auf dem neusten Sanierungsstand sind, drohen nach einem Verkauf empfindliche Mietsteigerungen«, skizziert Bernet die Situation auf dem Leipziger Wohnungsmarkt. An diesem Punkt will die SoWo mittels genossenschaftlicher Hausübernahmen intervenieren und Selbstverwaltungsmodelle mit bezahlbaren Mieten verbinden. Es sei wesentlich effizienter, bezahlbare Mieten im Altbaubestand durch dauerhaft nicht-profitorientierte Bewirtschaftung zu sichern, als Neubaukosten teuer zu fördern, meint Bernet. Doch die SoWo will auch Neubauprojekte unterstützen. Dabei handle es sich nicht um »Schöner-Wohnen-Projekte« eines gut verdienenden Mittelstands, betonen Schubenz und Bernet. Es gehe nicht um Einzelhausprojekte. »Wir wollen mehr Leuten sicheres, selbstverwaltetes Wohnen ermöglichen.« Dabei ist die Miethöhe selbstverständlich ein Knackpunkt.
»In der Merse 38c liegen die Mieten sogar unter dem Bestandsmieten-Durchschnitt in Leipzig und im Bereich dessen, was auch das Jobcenter übernimmt – obwohl dessen Sätze eigentlich schon lange realitätsfern sind«, sagt Bernet. Die niedrige Miethöhe war nur möglich, weil die Verkäuferin die Preise nicht in die Höhe getrieben hat. In dem zweiten Haus, in dem noch umfangreiche Sanierungen anstehen, werde die Miete höher ausfallen. Auf einem Zukunftswochenende der SoWo will man Voraussetzungen schaffen, damit die Genossenschaft im nächsten Jahr weitere Häuser erwerben kann. Das ist ausnahmsweise eine Expansion am Wohnungsmarkt, bei dem es nicht um mehr Profit geht.
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1102628.solidarische-wohnungsgenossenschaft-leipzig-solidaritaet-im-mietengerangel.html
Peter Nowak